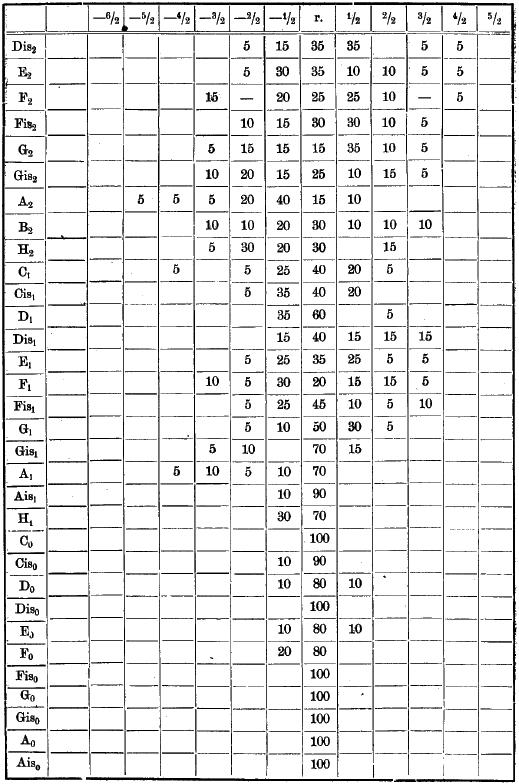
Originally published in Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, pages 1-86, 1901.
Otto Abraham, Berlin, Germany
Click here for the English translation of this article.
Die Bezeichnung »absolutes Tonbewußtsein« wird gewöhnlich für die Fähigkeit angewendet, einen Ton, ohne ihn in Verbindung mit anderen Tönen zu hören, mit der für ihn gebräuchlichen Buchstaben-Bezeichnung zu benennen. Der Ausdruck absolutes Tonbewußtsein wird aber außerdem für eine der obigen verwandte, aber nicht identische Fähigkeit gebraucht, die darin besteht, daß ein Ton, dessen Buchstaben-Bezeichnung genannt wird, frei aus dem Gedächtnis durch Singen beziehungsweise Pfeifen richtig produziert wird. Ich spreche ausdrücklich nur vom Singen und Pfeifen, weil bei der Produktion von Instrumentaltönen ganz andere Momente, die mit der als absolutes Tonbewußtsein bezeichneten Gabe nichts zu thun haben, sondern auf Mechanik und Technik beruhen, in Betracht kommen.
Wir nennen also den mit absolutem Tonbewußtsein begabt, der im stande ist, z. B. den Ton f, der ihm auf dem Klavier vorgespielt wird, ohne Anblick der Tasten und ohne kurz vorher andere Töne benannt gehört zu haben, richtig als f zu bezeichnen, ebenso auch denjenigen, der auf eine Aufforderung, frei aus dem Gedächtnis ein f zu singen, dieses vermag. Es ist nun nicht nötig, daß gerade die Buchstaben-Bezeichnung genannt wird, um das Tonbild zu reproduzieren, auch mit dem Notenzeichen und der Klaviertaste ist die Tonvorstellung verbunden. Welches die festere Verbindung ist, ist zweifelhaft und jedenfalls individuell verschieden. Sicherlich ist es aber nicht nötig, daß der mit absolutem Tonbewußtsein begabte Beobachter beim Anblick der Note oder der Taste erst an die mit diesem Zeichen verbundenen Wortbezeichnungen denkt, um die Vorstellung; zu erhalten; das Häufigere ist, daß Note und Taste direkt mit der Tonvorstellung verknüpft sind, so daß die drei Tonzeichen, ob optisch oder akustisch, als gleichwertig zu betrachten sind und sich auch in praxi für das absolute Tonbewußtsein nicht unterscheiden. Auseinanderhalten aber müssen wir die beiden Fähigkeiten, den gehörten Ton richtig zu benennen und den bezeichneten Ton richtig zu produzieren.
Wir können aus dem Umstande, daß ein und dieselbe Bezeichnung für zwei verschiedene Eigenschaften gebraucht wird, und daß für eine Fähigkeit das Wort Bewußtsein gesetzt wird, schon erkennen, daß die Benennung recht unglücklich gewählt ist. Sie ist aus dem Glauben entstanden, daß die Fähigkeit darauf basiert, daß eben der betreffende Ton im Bewußtsein vorhanden ist; ich möchte gleich a priori bemerken, daß dies durchaus nicht notwendig, ja nicht einmal die Regel ist, so daß die Bezeichnung für das, was darunter verstanden wird, falsch ist, zum mindesten nicht ausreicht.
Wer den Namen absolutes Tonbewußtsein erfunden hat, habe ich nicht ermitteln können, voraussichtlich ist es ein Musikschriftsteller gewesen, denn bis vor kurzem haben sich nur die Musiker, allerdings auch nur gelegentlich in biographischen Notizen, mit unserer Fähigkeit beschäftigt. Die Psychologie hat dieses Gebiet erst in neuester Zeit betreten und zwar ist es hier Stumpf[1]), welcher in seiner »Tonpsychologie« die meisten einschlägigen Fragen berührt hat. Nach ihm hat v. Kries[2]) in seiner Arbeit »Über das absolute Gehör« verschiedene Punkte einer besonderen Betrachtung unterworfen. Auf beide Arbeiten, die mir die Anregung zu meiner Abhandlung gegeben haben, werde ich verschiedentlich zurückkommen müssen und verzichte daher jetzt darauf, die Ansichten eingehender zu betrachten. Außer den beiden genannten Werken ist noch in letzter Zeit eine kleine Abhandlung von M. Meyer, mit welchem ich' selbst verschiedentlich zusammen gearbeitet habe, erschienen, über die ich ebenfalls in dem einschlägigen Kapitel referieren werde, ebenso wie über einzelne Arbeiten von Wallaschek, Planck und Naubert, in welchen nur einzelne Fragen dieses Gebiets berührt werden.
Daß eine so interessante Fähigkeit so selten wissenschaftliche Bearbeitung erfahren hat, das liegt hauptsächlich an dem geringen Material von geeigneten Versuchspersonen. Bei anderen tonpsychologischen Untersuchungen genügen meist geringe musikalische Kenntnisse und Beobachtungsgabe, hier aber muß man erst lange suchen, bis man einige Versuchspersonen findet, welche absolutes Tonbewußtsein haben. Meist sind dies Musiker, welche, wenn sie älter sind, keine Zeit für psychologische Experimente opfern können, während die jüngeren Musiker vielfach jede genauere Untersuchung für pedantisch und nicht vereinbar mit ihrem Künstlertum halten; auch läßt die Selbstbeobachtung derselben häufig viel zu wünschen übrig.
Ich habe meine Experimente mit wenigen mit unserer Fähigkeit begabten Musikern angestellt; die meisten Resultate stammen von mir selbst, der ich im Besitze eines sehr guten Tonbewußtseins bin. Um aber auch individuelle Verschiedenheiten dieser Fähigkeit zu ergründen, habe ich mir Fragebogen drucken lassen, und versandte sie an alle diejenigen Musiker, von denen ich wußte, daß sie ein absolutes Tonbewußtsein besaßen. Da ich in diesen Bogen um weitere Adressen bat, und mir diese Bitte meist in liebenswürdiger Weise erfüllt wurde, so bin ich jetzt in dem stolzen Besitz von hundert beantworteten Fragebogen, die mir ein überaus wertvolles Material lieferten. Die hervorragendsten Musiker, Geiger, Pianisten, Sänger, die ersten Psychologen und Selbstbeobachter haben mit Interesse den Fragebogen beantwortet, wofür ich ihnen allen hier noch einmal meinen wärmsten Dank ausspreche.
Die Fragen, zu welchen ich auf empirischem Wege gelangt bin, und welche absichtlich regellos hinter einander gereiht sind, lauten folgendermaßen:
1) Seit wann sind Sie im Besitze des absoluten Tonbewußtseins?
2) Spielen Sie ein Instrument? Welches? seit wann? Singen Sie? seit wann?
3) Komponieren Sie? Phantasieren Sie auf dem Klavier (resp. anderem Instrument)? Macht es Ihnen Schwierigkeit, zu bekannten Melodien die richtigen Bässe zu finden?
4a) Besteht Ihr absolutes Tonbewußtsein darin, daß Sie einen gehörten Ton richtig
benennen?
4b) Besteht Ihr absolutes Tonbewußtsein darin, daß Sie einen gewünschten Ton
durch Singen oder Pfeifen richtig angeben können?
4c) Können Sie beides ?
5) Haben Sie irgend eine Vorstellung, auf welche Weise Sie zu dem richtigen
Tonurteil gelangen?
a) Haben Sie sofort, sobald der Ton erklingt, seine Buchstaben-Bezeich nung,
ohne erst mit einem Ton, den Sie in der Erinnerung haben, zu ver gleichen?
b)
Vergleichen Sie den gehörten Ton mit einem Ton Ihres Bewußtseins?
c) Singen
Sie sich den gehörten Ton nach? Ist Ihnen dag eine Erleich terung für die
Beurteilung?
d) Können Sie sich einen gewünschten Ton denken, ohne ihn zu
singen oder sonst zu hören? In welcher Klangfarbe denken Sie sich den Ton? als
Geigen-, Gesangton u.s.w.
e) Vergleichen Sie den gehörten Ton mit dem
tiefsten beziehungsweise höchsten Singeton, den Sie hervorbringen können, und
beurteilen Sie danach den gehörten Ton ?
f) Haben Sie sonst irgend eine
Vorstellung von diesem psychologischen Vorgang?
6a) Ist es Ihnen leichter,
die Tonart einer Melodie zu erkennen, als einen einzelnen Ton?
6b) Ist es Ihnen leichter, die Tonart eines Akkordes zu erkennen, als einen
einzelnen Ton?
7a) Ist es Ihnen leichter, einen Ton nach dem Gedächtnis richtig zu singen,
wenn Sie sein Notenbild vor sich sehen?
7b) Ist es Ihnen leichter, einen Ton nach dem Gedächtnis richtig zu singen,
wenn Sie sich dabei ein bekanntes Lied vorstellen, dessen Anfangston der
gewünschte Ton ist?
8a) Hat Ihr absolutes Tonbewußtsein in der Höhe und Tiefe eine Grenze?
Welche?
b) Können Sie in irgend einer Oktave besser urteilen als in einer andern? In
welcher?
9) Muß ein Ton längere Zeit erklingen, damit Sie seine Höhe richtig
beurteilen können? Empfinden Sie für hohe und tiefe Töne dabei einen
Unterschied?
a) Muß ein Ton eine größere Stärke haben, damit Sie seine Höhe richtig
beurteilen können, oder können Sie auch ganz schwache Töne richtig benennen?
10) Irren Sie sich zuweilen im Tonurteil?
a) Um eine Oktave?
b) Um eine Quinte?
c) Um einen Halbton?
11a)
Haben Sie die Vorstellung, daß alle a z.B. etwas Gemeinsames, etwas Ähnliches
haben, daß sie von allen b, c u.s.w. unterscheidet?
b) Empfinden Sie diese Ähnlichkeit, vielleicht in geringerem Grade, auch
zwischen a und e?
12) Merken Sie, daß ein Instrument einen Viertel- oder Achtelton tiefer oder höher steht als ein anderes? (Natürlich nach genügender Zeitdistanz, um Intervall-Vergleichung auszuschließen.
13) Können Sie, wenn ein Lied vom Begleiter transponiert wird, dasselbe ohne Schwierigkeit singen, oder müssen Sie sich dasselbe erst ebenfalls im Geiste transponieren?
14) Macht in Ihrer Beurteilung die Klangfarbe der Instrumente einen Unterschied? Können Sie Geigen-, Klavier-, Gesang-, Orgel-, Glocken-, Gläser-, Blasinstrumenten-Töne gleich richtig beurteilen? Welche besser?
15) Haben Sie ein besonders gutes Melodie-Gedächtnis? Müssen Sie, wenn Sie sich eine Melodie im Geiste reproduzieren, sich dieselbe in der richtigen Tonart vorstellen, oder können Sie das auch in einer andern Tonart?
16) Haben Sie Ihr absolutes Tonbewußtsein durch besonders darauf gerichtete
Übung erlangt oder gebessert? Welcher Art war diese Übung?
a) Haben Ihre Eltern, Großeltern oder Geschwister ebenfalls ein absolutes
Tonbewußtsein oder andere hervorragende musikalische Eigenschaften?
17) Haben Sie irgend welche Farbenempfindung oder Farbenvorstellungen beim Hören von Tönen oder Tonarten? Welche?
18) Wie nennen Sie Ihr absolutes Tonbewußtsein? (Absolutes Ton bewußtsein, absolutes Gehör, absolutes Tongedächtnis, Tonsinn, Tongefühl, wie sonst?)
19) Kennen Sie noch andere Personen, die ein absolutes Tonbewußtsein besitzen, und würden Sie mir freundlichst deren Namen und Adresse mit teilen?
Man sieht, daß unter diesen 19 Fragen verschiedene recht einfach zu beantworten sind, während andere wieder ein gehöriges Selbststudium voraussetzen. Speziell was die Grenzen des absoluten Tonbewußtseins und den Einfluß der verschiedenen Ton-Qualitäten auf das Urteil anbetrifft, können die Antworten nur mit Reserve aufgenommen werden und dürfen nur die durch genaue Experimente gewonnenen Resultate unterstützen. Die psychologischen Experimente sind von mir ausschließlich im psychologischen Institut zu Berlin ausgeführt, dessen Direktor Herr Professor Dr. Stumpf mir sämmt-liche Apparate in freundlichster Weise zur Verfügung stellte, wofür ich meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Zunächst werde ich nur über die Beurteilung absoluter Tonhöhen sprechen.
Das Hauptpostulat, welches man an das absolute Tonbewußtsein stellen muß, ist, daß die Töne ohne Intervall-Vergleichung mit anderen Tönen in ihrer Höhe erkannt werden, d. h. richtig benannt werden.
Nun bezeichnen allerdings Personen von ganz geringer musikalischer Bildung gewisse Töne als hoch, und andere als tief, auch ohne sie mit anderen Tönen zu vergleichen. Diese Unterscheidungs-Fähigkeit für hoch und tief, wie von Kries (1. c.) sie nennt, ist aber doch verschieden von dem, was gemeinhin unter dem Begriff »absolutes Tonbewußtsein« oder »absolutes Gehör« verstanden wird. Wenn auch viele Namen für dieselbe Sache bestehen, so sind doch alle Beobachter über die Sache selbst einig, nämlich, daß der Ton mit dem Namen,' den er in der Tonskala hat, richtig bezeichnet werden muß. Es wäre danach also eine Unterscheidungs-Fähigkeit auf einen Halbton notwendig, wenn man von absolutem Tonbewußtsein sprechen darf. Das Wesentliche ist meiner Ansicht nach die Benennung. Der Ton und sein Name sind so häufig im Bewußtsein mit einander vereint erklungen, daß jedesmal, wenn der Ton erklingt und die Aufmerksamkeit auf seine Höhe gerichtet ist, der Name im Bewußtsein auftaucht. Es ist also bei den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musikern eine feste Association zwischen Tonbild und Wortbild entstanden, und so finden wir nicht nur einen quantitativen sondern einen Qualitäts-Unterschied zwischen dem absoluten Tonbewußtsein und der Unterscheidungs-Fähigkeit oder besser dem Gedächtnis für hoch und tief.
Die mit absolutem Tonbewußtsein Begabten sind sich gewöhnlich gar nicht klar, wie sie es anstellen, um zu dem richtigen Tonurteil zu gelangen; sobald der Ton erklingt, ist die Wortbezeichnung da. Es giebt allerdings auch viele, welche gewisse Hilfsmittel nötig haben, um das Tonurteil zu bewerkstelligen; die einen gebrauchen mittelbare Kriterien aus andern Sinnesgebieten her, die andern besitzen nur für einen oder wenige Töne ein absolutes Tonbewußtsein und müssen alle anderen Töne mittels ihres partiellen absoluten Tonbewußtseins und ihres Intervall-Bewußtseins erkennen.
Dieses Intervall-Bewußtsein, welches viel häufiger gefunden wird als das absolute Tonbewußtsein wird sehr häufig im Gegensatz zu diesem relatives Tonbewußtsein genannt. Es besteht darin die Höhe eines Tones durch Intervall-Abschätzung von einem andern Ton zu bestimmen. Man sieht schon hieraus, daß die Gegenüberstellung von absolutem und relativem Tonbewußtsein sehr unglücklich gewählt ist; jedenfalls kann man sie nicht derart anwenden, wie man sonst absolut und relativ gegenüberstellt. Wenn einem nur mit relativem Tonbewußtsein begabten Musiker ein Ton vorgespielt und ihm gesagt wird, der Ton heiße C, dann wird er gleich ein E richtig als E erkennen mittels seines Intervallsinns, der ihm sagt, daß der letztgehörte Ton die höhere große Terz zu dem ersten Tone ist. Da nun der erste Ton C heißt und die große Terz zu C E ist, so nennt er diesen Ton E. Wir haben hier also einen ganz anderen Gedankengang, ja einen logischen Schluß mit Prämissen und Konklusio vor uns, während bei dem absoluten Tonbewußtsein keinerlei Schluß oder nur bewußtes Denken stattfindet, sondern einfach beim Hören des Tons das Wortbild plötzlich auftaucht. Das Beste ist daher, den Namen »relatives Tonbewußtsein« als unlogisch fallen zu lassen und sich mit der Bezeichnung »Intervall-Sinn« zu begnügen.
In das Gebiet des Intervall-Sinns und nicht in das des absoluten Tonbewußtseins gehört auch das Gedächtnis für Klang-Kombinationen, mit welchem ein Akkord als Dreiklang, Quartsextakkord und dergleichen erkannt wird. Schon diese Bezeichnung der Akkorde beweist, daß es sich hier um Intervall-Urteile handelt. Wird dagegen das Urteil E dur-Drei-klang gefällt, dann gehört dies, falls nicht frühere Vergleichtöne herangezogen werden, in das Reich des absoluten Tonbewußtseins; zum mindesten gehört das Urteil E dahin, während das Urteil Dur und Dreiklang mittels des absoluten Tonbewußtseins oder des Intervall-Sinns gefunden sein kann.
Man glaubte früher, daß das absolute Tonbewußtsein von dem Intervall-Sinn nicht vollkommen zu scheiden wäre, weil noch eine Erinnerung an den zuletzt gehörten Ton bestehen könne, mit welchem man dann vergleiche. Das ist aber thatsächlich nicht der Fall; die Erinnerung an den zuletzt gehörten Ton verschwindet, wie auch Wolfe experimentell festgestellt hat[3]), ungemein schnell. Als scheinbarer Beweis, daß doch vielleicht der Intervall-Sinn auch bei dem absoluten Tonbewußtsein irgendwie mitspielt, wird angegeben, daß bei der Beurteilung zweier auf einander folgender Töne (z. B. b und es) der zweite Ton so benannt wird, daß seine Bezeichnung mit der des ersten Tons ein geläufiges Intervall ausdrückt. Der zweite Ton wird, wenn der erste b ist, meistens es genannt und nicht dis, auch bei Klaviertönen, bei denen ja kein Unterschied zwischen es und dis besteht. Man hat daraus schließen wollen, daß doch noch der Ton b im Bewußtsein ist, wenn es beurteilt wird, und daß daher eine Intervall-Vergleichung nicht strikte abzulehnen ist. Diesen Schluß möchte ich bestreiten. Ich erkläre mir die Beurteilung entweder nach dem häufigsten Vorkommen der Noten-Bezeichnung (es kommt musikalisch wohl häufiger vor als dis) oder dadurch, daß in der Erinnerung zwar nicht der Ton b wohl aber das Wort b sich befand, welches durch musikalische Übung, durch Lesen von Noten u. s. w. häufiger mit dem Worte es associiert ist, als mit dem Wort dis. Diese Erklärung scheint recht gewunden und unnatürlich, wird aber dadurch wahrscheinlich, daß auch bei großen Sprüngen etwa von B bis es4, sich dieselben Eigentümlichkeiten zeigen. Bei diesen großen Abständen kann von einer Intervall-Vergleichung nicht mehr die Rede sein, und bei der Schnelligkeit des Beurteilens ist auch ein geistiges Transponieren in die gleiche Oktave ausgeschlossen.
Wenn man aber den Intervall-Sinn ganz ausschalten will, dann lasse man der Versuchsperson größere Pausen zwischen den einzelnen Tönen, fülle die Pausen durch Gespräch aus, oder moduliere in ungewohnter Weise auf dem Klavier, so daß die Versuchsperson mittels Intervall-Sinns nicht zu folgen vermag. Dann wird man erkennen, daß das absolute Tonbewußtsein eine dauernde Fähigkeit ist, welche nicht abhängt von den zuletzt gehörten Tönen.
Wenn ich sagte, daß bei den meisten mit absolutem Tonbewußtsein Begabten gleich beim Hören des Tones sein Wortbild auftaucht, so bedarf diese Behauptung doch noch der Erläuterung. Nehmen wir an, es werde auf irgend einem Instrument der Ton d3 angegeben; dann weiß der mit absolutem Tonbewußtsein begabte Hörer sofort, daß diese Note d sei, nicht c und nicht e, aber welches d er eben gehört habe, das kann er erst nach einigem Nachdenken angeben; er überlegt sich erst, welches d man eigentlich d2, welches d3 nenne, und probiert dann herum, welche Bezeichnung passe, ja er singt oder pfeift sich d2 oder d3 vor, weil ihm bei diesen selbst producierten Tönen die Oktaven-Bezeichnung geläufiger ist. Wenn dieses Probieren in Wirklichkeit auch sehr schnell vor sich gehen kann, so ist doch ein ganz enormer Zeit-Unterschied zu konstatieren, ob das Urteil d oder d3 ausgesprochen wird.
Man könnte nun denken, daß der Grund dafür einfach darin liege, daß man in der Musik nicht gewohnt ist, die Oktavenhöhe mit anzugeben. Sicherlich kommt das auch in Betracht; ich selbst habe erst ziemlich spät, als ich mich mit akustischen Fragen beschäftigte, gelernt, die Bezeichnung der Oktavenhöhe den einzelnen Tonnamen gleich beizugeben, und ich brauche jetzt beträchtlich weniger Zeit als früher, um ein vollkommenes Höhen-Urteil abzugeben. Aber diese Gewöhnung erklärt keineswegs ausreichend, woher der Unterschied in den beiden Urteilsbildungen stammt, denn es ist nicht nur die Bezeichnung der Oktavenhöhe, sondern die Oktavenhöhe selbst, über welche man im Unklaren ist. Während nämlich in mittleren Tonlagen. Irrtümer von einem Halbton eine große Seltenheit sind (für einen Musiker, der nicht durch zuviel verschiedene Stimmungen der Instrumente irre geleitet wird), sind Fehler in der Oktaven-Erkennung, nicht nur in deren Bezeichnung, sehr häufig. Recht beweisend ist das Experiment, welches E. Engel[4]) in seiner Broschüre über die Klangfarbe erwähnt hat. Er ließ den tiefsten Pfeifton hervorbringen (d2) und diesen vergleichen mit einem gleich darauf gesungenen kräftigen Tenor d1. Die meisten Hörer mit und ohne absolutem Tonbewußtsein halten den gesungenen Ton für höher als den gepfiffenen. Ein mit absolutem Tonbewußtsein begabter Musiker würde also im Zweifel sein, ob der gepfiffene Ton d0, d1 oder d2 ist, würde aber niemals das d etwa mit des verwechseln. Ich habe dieses Experiment mit 10 Versuchspersonen angestellt, die ausnahmslos in der geschilderten Weise reagierten. Ja mir selbst, der ich genau weiß, daß der gepfiffene Ton d2 ist, will er immer noch als d1 erscheinen; früher hielt ich ihn sogar für d0. Erst durch Vergleichung mit Instrumentaltönen oder, indem ich im Geiste die Skala hinaufsteige, gelange ich etwa bei a2 zum richtigen Urteil. Dieses a2 verwechsle ich nämlich nicht mehr mit at; nur die tiefen Pfeiftöne haben durch ihre dunkle Klangfarbe die Eigentümlichkeit, tiefer zu erscheinen, als sie sind. Wir sind es gewohnt, obertonreiche Klänge zu hören; obertonlose Töne erscheinen uns im Vergleich zu diesen tiefer.
Stumpf[5] erklärt diese Oktaven-Täuschung in folgender Weise:
Teilweise beruht dies auf der Ähnlichkeit, welche zwischen einem zusammengesetzten Klang, als Ganzes betrachtet, insofern besteht, als letzterer im ersteren als Teil erhalten ist. Da uns nun der Grundton für sich allein weniger vertraut ist, so benennen wir ihn nach demjenigen gewohnten Klange, mit welchem er die größte Ähnlichkeit besitzt. Und diese Ähnlichkeit wirkt auch, ohne daß der zusammengesetzte Ton selbst vorgestellt wird, indem sie als reproducierende Kraft die Übertragung des entsprechenden Begriffs und Namens auf den vorliegenden einfachen Klang bewirkt. Derselbe besitzt allerdings auch eine Ähnlichkeit mit seinen einfachen Nachbartönen, aber diese sind uns als einfache Töne ebensowenig vertraut, wie er selbst, also liegt die Verwechslung mit ihnen weniger nahe, als mit der zusammengesetzten tieferen Oktave. Zum Teil aber beruht die Oktaventäuschung auf der Verschmelzung. In den Fällen, wo die Benennung sich auf eine Vergleichung des vorliegenden mit einem konkret vorgestellten Klang gründet, stellen wir uns einen solchen Klang vor, mit welchem (mit dessen Grundton) der gegebene einfache Klang am stärksten verschmilzt und benennen diesen danach. Infolge davon könnte der einfache Klang zwar ebensowohl um eine oder mehrere Oktaven zu hoch oder zu tief geschätzt werden ; aber daß er überhaupt zu tief geschätzt wird, hat die schon angeführten Gründe; hier war nur zu erklären, warum gerade um Oktaven. So löst sich die Paradoxie, daß Musiker bei absoluten Höhenbestimmungen sich leichter um einen bestimmten größeren als um einen kleineren Betrag irren.
Diesen Stumpf sehen Erklärungen muß man, glaube ich, da sich die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker nicht nur bei einfachen Tönen, sondern auch bei mehr oder weniger obertonreichen Klängen um Oktaven irren, noch hinzufügen, daß bei diesen noch das Gefühl für Klangverwandtschaft der Oktaven besonders stark ausgeprägt sein muß. Man spricht im Tongebiet wie in allen anderen Gebieten von Ähnlichkeit und unterscheidet zwischen Ähnlichkeit des Zusammengesetzten und Ähnlichkeit des Einfachen. Die Ähnlichkeit des Zusammengesetzten kann bedingt sein durch gleiche Verhältnisse und gleiche Teile, bei der Ähnlichkeit des Einfachen kann man dagegen keine partielle Gleichheit entdecken. Aber daß wir die einen Töne hoch, andere tief nennen, und so verschiedene Töne unter denselben Begriff subsumieren, ist ein Beweis, daß solche Ähnlichkeit existiert und auch empfunden wird. Ich glaube, daß hierin nun ein Fundamentalunterschied besteht zwischen den Musikern, welche ein absolutes Tonbewußtsein haben, und denen, welche nur nach Intervallen urteilen. Die meisten der letzteren erklären die Ähnlichkeit zwischen beispielsweise G und Cis für bedeutender als zwischen c und fis. Bei den mit absolutem Tonbewußtsein Begabten dagegen zeigt sich sonderbarerweise, daß sie überhaupt keine oder nur sehr geringgradige Empfindung für die Ähnlichkeit des Einfachen im Tongebiet haben; ein Cis ist für sie dem G ebenso unähnlich wie ein Fis oder ein h3. Dagegen empfinden sie eine übergroße Ähnlichkeit des Zusammengesetzten. Speziell die Oktave steht in der Verwandtschaft obenan. Doch auch für die Quinte und die große Terz wird mehrfach angegeben, daß sie zum Verwechseln ähnlich seien. Ich habe unter meinen Fragebogen-Beantwortern mehrere gefunden, welche sich leicht um eine Quinte, sehr viele, welche sich um eine Oktave irren, und einen, welcher öfter Fehler um eine große Terz macht. Alle diese Beobachter sind solche, welche sich nur ausnahmsweise um einen Halbton irren.
Diese Ähnlichkeit der Oktaven beruht auf Gleichheit der Teile; an eine Gleichheit der Verhältnisse kann hier nicht gedacht werden, weil diese bei allen Tönen derselben Klangfarbe dieselbe wäre. Die gleichen Teile sind hier die zusammenfallenden Obertöne. Für diese Ähnlichkeit des Zusammengesetzten also besitzen die mit absolutem Tonbewußtsein Begabten eine starke Auffassungsfähigkeit im Gegensatz zu der Ähnlichkeit des Einfachen. Nun könnte jemand einwenden, daß man nur die Distanz zweier Töne immer mehr zu verringern brauche, um bei jedem Beobachter ein Ähnlichkeits-Urteil zu erzwingen. Man brauche ja nicht c und cis zu nehmen, sondern zwei Töne, welche nur wenige Schwingungen aus einander liegen. Wenn man diese zwei Töne hört, wird man sie allerdings für ähnlicher erklären, als etwa ein c und fis3. Doch bei dem absoluten Tonbewußtsein handelt es sich um eine Gedächtnis-Qualität, keine Empfindungs-Eigenschaft. Im Gedächtnis können wir für längere Zeit, wie nachher an Tabellen geprüft werden wird, Töne, welche nur um wenige Schwingungen von einander abweichen, nicht aus einander halten, die beiden Töne würden also für das Empfindungs-Urteil ähnlich, für das Gedächtnis-Urteil gleich zu nennen sein; und da, wo für das absolute Tonbewußtsein die Gleichheit aufhört, endigt auch die Ähnlichkeit. Ich glaube daher, daß die Art der Ähnlichkeits-Urteile für das absolute Tonbewußtsein von großer Wichtigkeit ist; ob sie eine Ursache oder Folge des absoluten Tongedächtnisses sind, das möchte ich vorläufig unberührt lassen. Vielleicht lassen sich die Verhältnisse so erklären, daß ursprünglich bei gewissen Menschen die einzelnen Töne einen bestimmten, nur ihnen zukommenden Gefühls-Eindruck hinterlassen. Der Ton erscheint ihnen als eine Individualität, auf ihn konzentrieren sie ihre Aufmerksamkeit und vernachlässigen die Beziehungen der Töne unter sich. Dadurch verengen sie einerseits ihren Tonbegriff und andererseits geht ihnen das Bewußtsein für die Ähnlichkeit mit den benachbarten Tönen verloren. Dies kann dann zur Erwerbung eines absoluten Tonbewußtseins führen.
Es ist klar, daß eine Fähigkeit wie das absolute Tonbewußtsein, die darin besteht, Tonhöhen-Urteile abzugeben, abhängen muß von Qualitäten der Töne und Qualitäten des Individuums, das heißt: derselbe Ton kann von verschiedenen Hörern ungleich beurteilt werden, der eine Musiker kann seine Höhe bestimmen, der andere nicht, ein dritter braucht einen mittelbaren Weg, um zum Urteil zu gelangen. Ebenso kann aber auch derselbe mit Tonbewußtsein begabte Hörer sich den verschiedenen Ton-Qualitäten gegenüber ungleich verhalten; die einen Töne kann er bestimmen, andere nicht, manche auf unmittelbarem, andere auf mittelbarem Wege. Hierbei sind sämtliche Ton-Qualitäten von Wichtigkeit, die Tonhöhe, die Intensität, die Dauer und die Klangfarbe.
Von allen Ton-Qualitäten spielt naturgemäß die Tonhöhe die weitaus größte Rolle für das absolute Tonbewußtsein. Wenn auch ein Mensch im stande ist, manche Töne nach ihrer absoluten Höhe richtig zu benennen, so ist damit noch nicht gesagt, daß er alle Klänge, die in ihm Tonempfindungen erregen, auch beurteilen kann.
Wir müssen unterscheiden:
1) physikalische Töne. Dieselben bestehen aus regelmäßig auf ein ander folgenden Gleichgewichts-Störungen der Luft; der Umfang der physi kalischen Töne ist unendlich groß, wenigstens theoretisch, wenn auch, zumal in der Höhe, der mechanischen Ausführbarkeit Grenzen gesetzt sind.
2) Töne, welche im Menschen Tonempfindungen erzeugen. Die Grenze derselben erstreckt sich nach den neuesten Untersuchungen von Stumpf und Meyer und Karl L. Schäfer in der Norm von 16 Schwingungen bis ca. 20000.
3) Töne, welche musikalisch verwendet werden. Deren Umfang beträgt ca. 7 Oktaven und bewegt sich zwischen den Tönen 50 und 4000.
Es ist nun ziemlich wichtig zu berechnen, in welchem Tonumfange man im stande ist, absolute Höhenurteile abzugeben und dann mit diesen verschiedenen Grenzgebieten zu vergleichen, um zu erkennen, ob die Begabung des absoluten Tonbewußtseins in Zusammenhang steht mit Empfindung oder mit der musikalischen Übung.
Selbstverständlich sind auch hierbei Wie bei den meisten das absolute Tonbewußtsein betreffenden Fragen große individuelle Verschiedenheiten festzustellen. Der eine kann überhaupt nur einen einzigen Ton richtig nach der absoluten Höhe benennen, ein zweiter vermag wenige Oktaven, ein dritter das ganze musikalische Tongebiet und noch darüber hinaus richtig zu beurteilen.
Diejenigen, bei denen das absolute Tonbewußtsein auf einen Ton, z. B. den Kammerton a1; oder wenige Töne, z. B. a und c, beschränkt ist, rangieren eigentlich nicht hierher. Diese haben, wie nachher besprochen werden wird, ihr absolutes Tonbewußtsein meist durch mittelbare Kriterien erlangt; es kommt bei ihnen nicht solch spontanes Auftauchen des Wortbildes zu stande, wie ich oben ausführte, und wie alle es beschreiben, welche die Association rein durch das Tonbild bewerkstelligen. Auch ohne diese Gruppe ist die individuelle Verschiedenheit des Tonumfangs bedeutend, und es hätte wohl keinen Zweck, darüber große zeitraubende Versuchsreihen anzustellen. Dagegen ist es interessant, solche Personen auszuwählen, welche nach kurzen Vorversuchen einen bedeutenden Umfang ihres Urteilsgebietes aufweisen können, und so das Maximum des Tonumfangs zu bestimmen. Ich bin nun in der glücklichen Lage, dabei selbst als Versuchsperson fungieren zu können; jedenfalls habe ich mein Urteilsgebiet als größer erkannt als das anderer daraufhin untersuchter Beobachter. Obwohl nun wahrscheinlich Musiker existieren, die mich hierin übertreffen, glaube ich doch berechtigt zu sein, meine Versuche zu veröffentlichen, um so mehr, als sie ein interessantes Bild geben, wie genau reihenartig nach Höhe und Tiefe hier die Fehlerquellen zunehmen. Die Versuche stellte ich zusammen mit Herrn Giering an,- welcher sie für eine andere Abhandlung ebenfalls verwendet hat. Für die Tiefenregion benutzten wir Edelmann'sche Stimmgabeln, für die Höhe kleine mittels Blasebalges angetriebene Orgelpfeifen. Wir stellten mit jedem Ton Versuche an. In folgender Tabelle sind in der linken Querreihe die Tonhöhen, in der wagerechten Reihe die procentualischen Verhältnisse der richtigen und falschen Fälle angegeben nebst der Fehlergröße.
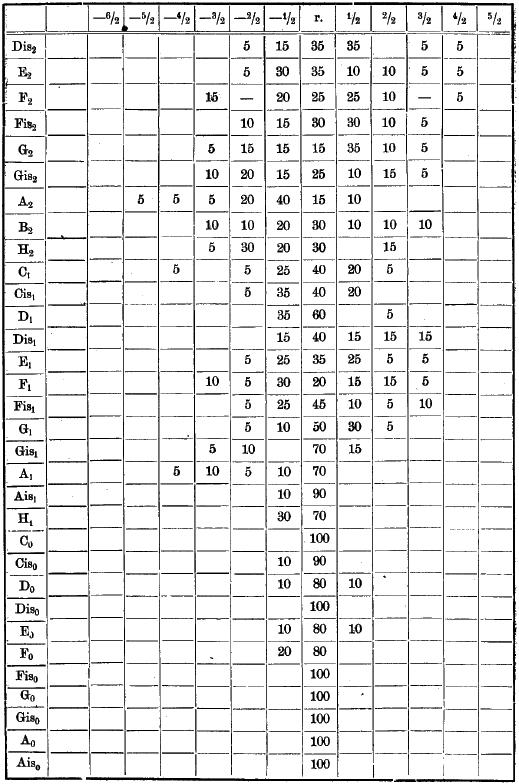
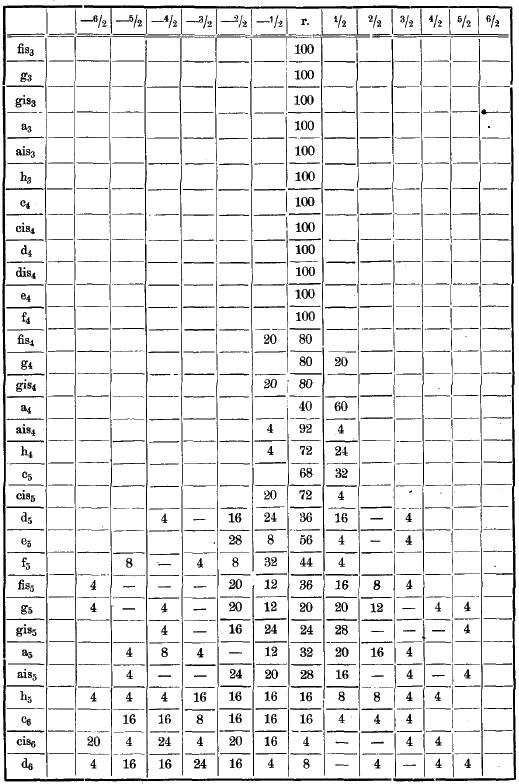
Betrachten wir beide Tabellen oberflächlich, so fällt sofort auf, daß die Sicherheit im Tonurteil größer ist bei den musikalisch gewohnten Klängen als in den Grenzregionen, und zwar nimmt die Anzahl der richtigen Fälle in ziemlich konstanter Art zu nach den mittleren Tonlagen. Für beide Reihen sind aber einige Nebenumstände zu berücksichtigen: Die Stimmung des tiefen Stimmgabeltons wie der Pfeifenklänge ist die normale Stimmung mit at = 435 Schwingungen pro Sekunde. Nun habe ich aber, wie in späteren Tabellen ausgeführt wird, ein a1 im Bewußtsein, welches weit höher ist, nämlich ca. 446 Schwingungen betragt. Ein a1 = 435 scheint mir daher zu tief; erst allmählich kann ich mich in die tiefe Stimmung hineindenken. Daher sind, glaube ich, viele Fehler auf dieses Moment zurückzuführen, natürlich nur Fehler, die einen Halbton betragen können. Aber nicht nur zu tiefe Urteile entstehen durch diese abweichende Privatstimmung, nein, in dem Bestreben, mich der Instrumentalstimmung anzupassen, schieße ich oft über das Ziel hinaus und verfalle in den Fehler, zu hoch zu urteilen. Ich glaube daher, daß die Fehler, die eine halbe Tonstufe nach oben und unten betragen, nicht gerechnet werden dürfen, sondern daß man das Urteil »richtig« auf den gespielten Ton und seine Nachbar-Halbtöne ausdehnen muß. Auf diese Weise wird auch die Konstanz der Reihe eine viel ausgeprägtere.
Wenn man sich aber die Urteilsreihe der tiefen Töne betrachtet, dann scheint es sehr merkwürdig, daß in den allertiefsten Regionen, wo bereits die Grenze der Wahrnehmung nahe liegt, richtiger geurteilt wurde als in weniger tiefen Lagen. Der tiefste untersuchte Ton, das Subcontra Dis, wurde bei Zurechnung der Nebenhalbtöne in 100% der Fälle richtig beurteilt, während die Mitte der Kontraoktave nur 70 bis 90% richtige Urteile aufweist. Dieses scheinbar paradoxe Faktum ist aber leicht zu erklären: Die tiefsten Töne sind diskontinuierlich, sie erscheinen brummend, in noch größerer Tiefe schnarrend, ja flatternd. Die einzelnen Schwingungen sind beinahe an den Stößen zu zählen, jedenfalls zu schätzen. Dieses Flattern des Tones prägt sich so scharf dem Ohre ein, daß man nach genügender Zeit, und zeitraubend sind diese Versuche ja sehr, sich derart einüben kann, die Geschwindigkeit der Tonstöße zu schätzen, und so den Ton ziemlich richtig zu benennen. Man könnte danach womöglich also einen Ton in seiner absoluten Höhe richtig bestimmen, ohne absolutes Tonbewußtsein zu haben, doch ist das erst ein mittelbares Erkennen, wenn auch die Tonstöße nur Qualitäten der tiefen Töne allein sind und kein anderer Sinn zu Hilfe genommen wird als das Gehör. Trotzdem wird ein mittelbares Kriterium zu Hilfe genommen, die Fähigkeit der Zeiten-Schätzung. Wenngleich bei mir die Beurteilung der Tonstoß-Geschwindigkeit keine so vollkommene ist, so erleichtert sie doch das Tonurteil bedeutend; falsche Urteile werden nochmals genau geprüft, schwankende bekräftigt durch dieses Kriterium. So ist das paradoxe Faktum zu erklären, daß die tiefsten Töne so gut beurteilt wurden.
Auch dies ist noch zu erwähnen, daß nicht mit absoluter Sicherheit das Vorhandensein von Obertönen an den tiefsten Gabeltönen auszuschließen ist. Die Töne schienen uns zwar obertonlos zu sein, aber da für diese Tiefen keine Resonatoren existieren, so ist es nicht ganz sicher.
In der Höhengrenze haben wir kein mittelbares Kriterium wie bei den tiefen Tönen, und darum nimmt auch die Anzahl der falschen Fälle nach der Höhe viel konstanter zu.
Die Kurve der richtigen Urteile meines absoluten Tonbewußtseins würde also nach den beiden Tabellen folgende sein:
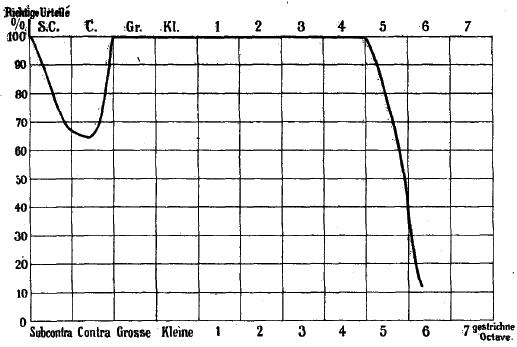
Die Urteile von der kleinen bis zur dreigestrichenen Oktave sind nicht tabellarisch fixiert, sie waren ausnahmslos richtig. Man sieht, daß die Tiefengrenze viel genauer beurteilt wird als die hohen Oktaven aus dem erwähnten Grunde. Von der Mitte der fünfgestrichenen Oktave an sind die richtigen Urteile als Zufalls-Urteile zu betrachten. Die Töne erscheinen mir von da ab scharf und spitzig, und ich kann mir jeden beliebigen Ton unter ihnen vorstellen. Speziell hatte ich die Neigung, immer ein fis, eis oder gis, jedenfalls einen Ton mit einem is-Laut im Namen mir als die Tonhöhe zu denken, wahrscheinlich weil der spitze Charakter der höchsten Töne diese Association mit dem spitzen Tonnamen bewerkstelligt. Jedenfalls liegt die Höhengrenze für mein Tonbeurteilungs-Vermögen in der Mitte der fünfgestrichenen Oktave. Ob ich durch Übung noch höher gelange, weiß ich nicht, jedenfalls waren die Versuche in diesen Regionen an allen Versuchutagen gleich fehlerhaft. Die Tiefengrenze meines absoluten Tonbewußtseins kann ich kaum bestimmen, da ich das mittelbare Kriterium nicht eliminieren kann. Dieses aber eingerechnet, fällt die Grenze meines absoluten Tonbewußtseins mit der Empfmdungsgrenze zusammen, während in der Höhe noch zwischen beiden ein bedeutender Zwischenraum liegt. Dagegen geht mein absolutes Tonbewußtsein über die Grenze des musikalischen Tongebrauchs nach beiden Richtungen hin hinaus.
Man sieht daraus, daß, wie auch schon Stumpf angiebt, das absolute Tongedächtnis hier nicht parallel mit der Unterschieds-Empfindlichkeit geht. Stumpf[6] fand dagegen, daß in der Tiefe weit schlechter geurteilt wurde als in der Höhe. Wenn ich das Gegenteil gefunden habe, so ist das nur ein scheinbarer Gegensatz. Denn während ich von der Subkontra-Oktave bis zur fünfgestrichenen Oktave experimentierte, ist die Distanz der Stumpfschen Versuchstöne nur vom C1 bis zum fis4, für welche auch meine Urteile im Sinne Stumpf's ausfallen, denn die Unsicherheit der hohen Töne fängt erst mit der Mitte der fünfgestrichenen Oktave an, während die Sicherheit nach der Tiefe jenseits der Kontra-Oktave, wie erwähnt, zunimmt.
. Wir kommen jetzt zur Betrachtung der zweiten Ton-Qualität, der Tonstärke, und wollen ihren Einfluß auf absolute Höhenurteile untersuchen. Über Ton-Intensitäten Versuche anzustellen, ist immer eine recht mißliche Sache, weil leider noch keine genügenden Apparate existieren, mit welchen man die physikalische Intensität eines Tones messen könnte.
Wir müssen unterscheiden zwischen Reizstärke (Intensität des physikalischen Tones) und Empfindungsstärke[7]. Es leuchtet ein, daß es eine Reizstärke geben kann, welche nicht zur Empfindung zu gelangen braucht. Sehr schwache Tonreize, die das Trommelfell treffen, können die Widerstände in diesen, in den Gehörknöchelchen und in den weiteren Teilen des inneren Ohres nicht überwinden und kommen so gar nicht bis zur Erregung des Gehörnerven. Aber auch, wenn eine sehr schwache Reizung des Gehörnerven stattgefunden hat, braucht immer noch keine Empfindung zu entstehen. Man muß annehmen, daß ebenso wie der Schall durch seine Fortpflanzung in der Luft geschwächt wird, er auch in einem anderen Medium, hier der Nervenmasse, völlig ausgelöscht werden kann. Wenn man aber selbst Apparate hätte, mit denen man die Reizstärke genau messen könnte, und wenn man auch den Leitungs-Widerstand der Nerven ausrechnen könnte, würde man doch nicht im klaren sein über die zur minimalen Empfindung nötigen Reizstärke-Prozente. Denn sobald wir ein Urteil abgeben über eine Empfindung, müssen wir diese Empfindung wahrgenommen haben; wir urteilen dann über die Wahrnehmungs-Schwelle und nicht über die Empfindungs-Schwelle. Denn es ist sehr wohl denkbar, daß eine wirklich vorhandene Empfindung nicht bemerkt zu werden braucht wegen allzugeringer Stärke, wegen Mangel an Aufmerksamkeit, wegen Ermüdung und anderer äußerer Umstände. Beide Schwellen, die der Empfindung und der Wahrnehmung, würden sich nähern bei günstigen Bedingungen, bei großer Aufmerksamkeit und äußerster Stille. Im allgemeinen aber schwankt die Wahrnehmungs-Schwelle bedeutend.
Man kann weiterhin einen ganz schwachen Ton wahrnehmen, ohne über seine Höhe eine Aussage machen zu können. Die Beurteilung der absoluten Tonhöhe kommt erst zu stande nach einer Art Analyse der Empfindung; erst nachdem man eine Ton-Empfindung wahrgenommen hat, kann man die verschiedenen Qualitäten: Höhe, Stärke, Klangfarbe, Dauer einzeln analysieren. Man kann also bei einer gewissen minimalen Stärke sagen, daß man etwas Tonartiges wahrgenommen hat, aber bei einer anderen Intensität erst die Tonhöhe bestimmen. Es muß also psychologisch unterschieden werden zwischen Schwellen der Empfindung, der Wahrnehmung und des Höhen-Urteils; letztere ist wahrscheinlich verschieden für absolute und relative Höhen-Urteile.
Die numerischen Werte, welche von den einzelnen Untersuchern für die Wahrnehmungs-Schwelle herausgerechnet sind, beziehen sich teils auf Geräusche, teils auf Töne. Für Stimmgabel-Töne hat Conta[8] die Datier gemessen, innerhalb deren eine kräftig angeschlagene Stimmgabel noch gehört wird. Boltzmann und Töpler haben nach der Enfernung, in welcher ein Pfeifenton von 181 Schwingungen (fis) noch zu hören war, die Schwingungsweite eines Luftteilchens für den eben hörbaren Ton auf 0,00004 und die mechanische Arbeit, welche dabei an das Ohr abgegeben wird, auf 1/3 Billionen Kilogrammeter berechnet. Rayleigh soll noch weit geringere Werte eruiert haben[9].
Wenn diese Untersuchungen schon ihre großen Schwierigkeiten haben, so wachsen dieselben doch noch bedeutend bei der Berechnung der für ein absolutes Höhen-Urteil erforderlichen Reizstärke. Wie oben gesagt, gehört zur Höhen-Beurteilung eine Art Analyse der einzelnen Ton-Qualitäten. Jeder Ton hat seine Nebengeräusche, und erst wenn die Intensität derselben verschwindend klein ist gegen die Intensität des Tones oder wenigstens so gering ist, daß die Aufmerksamkeit von ihr abgezogen wird, ist ein Höhen-Urteil möglich. Wollte man nun z. B. die Boltzmann-Töpler'sche Versuchs-Anordnung für diese Frage anwenden, dann müßte stillschweigend angenommen werden, daß der Ton und die Nebengeräusche durch die Entfernung von der Schallquelle proportional abgeschwächt werden. Das ist aber keineswegs bewiesen, im Gegenteil scheint es, daß die Empfindungsstärke der Geräusche mit der Entfernung des tönenden Objektes rascher abnimmt als die der Töne. So giebt Stumpf[10] an, daß Militärmusik im Zimmer besser zu differenzieren sei als im Freien, da die Straßen-Geräusche ein Hindernis der Ton-Perception bildeten: diese würden durch die Wände und die Entfernung mehr abgeschwächt als die Töne.
Untersuchungen über den Schwellenwert der Ton-Intensität, welcher für das absolute Höhen-Urteil erforderlich ist, können also auf diese Weise nicht angestellt werden; erst wenn wir im stände sind, willkürlich Reizstärken verschiedenen Grades bis zu den geringsten zu produzieren und physikalisch zu berechnen, dann wird es möglich sein, in diese Sache Klarheit zu schaffen.
Ob bei der Höhen-Beurteilung die Intensität des Tones nur so groß sein muß, um eine Analyse zu ermöglichen, oder ob für den Associations-Proceß (zwischen Tonbild und Wortbild) noch ein Plus von Stärke nötig ist, kann auch noch nicht beantwortet werden. Bei allen Versuchen, welche ich über ganz kurze und ganz schwache Töne anstellte, zeigte sich aber, daß jedesmal, wenn einer der musikalisch geübten Mitarbeiter, welcher aber kein absolutes Tonbewußtsein besaß, den Grundton analysierte, d. h. ihn etwa nachsingen konnte, auch bei mir das absolute Tonhöhen-Urteil fertig war. Die Grenze war so scharf, daß wir fast im selben Moment uns ein Zeichen gaben. Dies würde allerdings auch nur beweisen, daß für den psychischen Vorgang im Gehirn, der das Nachsingen vorbereitet, und den, welcher das absolute Höhenurteil bewerkstelligt, dieselbe Minimalintensität des Tonreizes erforderlich ist.
Wie weit sich die absolute Höhenurteils-Schwelle von der Wahrnehmungs-Schwelle entfernt, das liegt an der Analysierungs-Fähigkeit, Übung und Ermüdung des Einzelnen. Bei sehr geübten Beobachtern und günstigen Bedingungen liegen Wahrnehmungs- und Höhenurteils-Schwelle dicht neben einander.
Auch abgesehen von der Intensitäts-Schwelle ist ein Einfluß der Tonstärke auf das Höhenurteil zu bemerken. Ein sehr starker Ton, etwa ein starker Posaunenklang, wird weit schwerer seiner absoluten Höhe nach bestimmt als ein leiserer Ton; das liegt daran, daß bei den lauteren Klängen mehr Obertöne und auch mehr Nebengeräusche mitempfunden werden, als bei den leiseren Tönen. Besonders erkennt man dies an Klängen, in welchen einzelne Obertöne besonders stark hervortreten, etwa an Glocken-und Gläser-Tönen; je leiser man ein Glas anschlägt, um so leichter wird man den Grundton desselben analysieren können, und so die Tonhöhe bestimmen. Manchen ist es überhaupt unmöglich, einen lauten Gläser- und Glocken-Ton richtig zu benennen, während es ihnen bei schwacher Intensität leicht gelingt; das Stärke-Optimum für die absolute Höhenbeurteilung liegt also zwischen Stärke-Maximum und Stärke-Minimum beträchtlich nach der Seite des letzteren zu.
Ein weiterer Einfluß der Stärke auf das Höhenurteil besteht darin, daß stärkere Töne meist für höher taxiert werden, als schwache Töne derselben Schwingungsanzahl; daß der Grund dieser Täuschung in der Empfindung zu suchen sei, erscheint unwahrscheinlich. Stumpf führt in seiner »Tonpsychologie« (I S. 238 f.) mehrere eigene Argumente und solche anderer Forscher dagegen an. Zur Erklärung der sicher bestehenden Urteils-Täuschung erinnert Stumpf erstens daran, daß häufig eine nachwirkende Erfahrung über das Sinken der Tonhöhe bei einem Sänger, dem der Atem und die Kraft ausgeht, mitspielen kann. Solche Eindrücke haben eine Gewohnheit hinterlassen, an ein Sinken des Tones bei abnehmender Stärke desselben auch in solchen Fällen zu glauben, wo die Art der Tonerzeugung ein wirkliches Sinken ausschließt. Eine andere Ursache der Täuschung liege zweitens in dem Umstande, daß höhere Töne bei gleicher Reizstärke größere Empfindungsstärke besitzen. Die Erfahrungen in dieser Hinsicht lassen unwillkürlich das hinsichtlich der Tonhöhe schwankende Urteil durch den Gesichtspunkt der größeren Stärke bestimmt werden, auch wo nicht die Empfindungsstärke allein, sondern die Reizstärke selbst größer ist. Drittens werden beim schwächeren Anschlagen eines Tones weniger Obertöne erzeugt. Die Beimischung von Obertönen gebe aber jedem Tone einen höheren Anstrich, weil das Klanggefühl dadurch dem der höheren Töne ähnlich werde. Im allgemeinen kommt dieser Einfluß der Tonstärke für das absolute Tonbewußtsein kaum in Betracht. Die geringen Distanzen, um welche der stärkere Ton höher erscheint als der schwächere, betragen meist nur so wenig Schwingungen oder nur Bruchteile derselben, daß diese für die Höhen-Beurteilung eines einzelnen Tones mittels eines absoluten Gehörs nicht mitsprechen können. Der Ton wird darum doch mit demselben musikalischen Namen benannt, der für einen weit größeren Bezirk (in mittleren Tonlagen 40--100 Schwingungen umfassend) gebraucht wird. Für Intervall-Vergleichung ist diese Urteils-Täuschung eher von Belang. Immerhin wäre es interessant, sowohl für das Vergleichen zweier Töne als auch für die absolute Höhen-Beurteilung den Einfluß dieser Täuschung möglichst numerisch festzustellen; doch kann dies erst gelingen, wenn wir Apparate zur Intensitäts-Messung der Reizstärke haben, und wenn wir mit Hilfe dieser tabellarisch notiert haben, in welchem Verhältnis die Reizstärke zur Empfindungsstärke bei verschiedenen Tonhöhen steht.
Eine weitere Ton-Qualität, deren Beziehung zum absoluten Tonbewußtsein zu untersuchen ist, und welche sich der Intensität anschließt, ja zu ihr in engster Beziehung in den beiderseitigen Schwellenwerten steht, ist die Tondauer. Wir müssen hierbei unterscheiden zwischen der notwendigen Dauer eines einzelnen Tones und der eines Tones, der nur ein Glied einer Tonreihe bildet. Auch hierbei muß das Empfindungs-Urteil (Existentialurteil) von dem absoluten Tonhöhen-Urteil gesondert betrachtet werden. Man hat sich also, um zunächst nur von der Dauer eines einzelnen Tones zu sprechen, folgende Fragen vorzulegen:
1) Welches ist die Minimaldauer eines Tones für das Zustandekommen einer Tonempfindung?
2) Welches ist die Minimaldauer eines Tones für die Bildung eines absoluten Höhenurteils?
Über beide Fragen habe ich eingehende Untersuchungen in Gemeinschaft mit L. I. Brühl angestellt, welche in der Zeitschrift für Psychologie, Band 18, veröffentlicht sind. Ich verweise deshalb im einzelnen auf diese Abhandlung und möchte hier nur in Kürze die Versuchs-Anordnung und die gewonnenen Resultate angeben.
Wir stellten uns die Aufgabe, möglichst kurze Töne zu erzeugen, deren Schwingungsanzahl und Dauer leicht zu berechnen ist, und ihre Einwirkung auf Empfindung und Höhenurteil zu untersuchen. Am zweckmäßigsten erschienen uns für diesen Zweck die Töne, welche man durch Anblasen einer Sirenen-Scheibe gewinnt. Auf einer kreisrunden Aluminium-Scheibe, welche einen Durchmesser von 80 cm hat, ließen wir auf zwei konzentrischen Kreisen Löcher derart ausstanzen, daß bei derselben Größe der Löcher (Durchmesser 2 mm) und gleichem Abstand von einander (kürzeste Verbindung 2 mm) auf dem größeren Kreis 500, auf dem kleineren 300 Locker entstanden. Die Scheibe wurde in ihrem Mittelpunkt gedreht in verschiedener Geschwindigkeit, welche wir durch Handtrieb oder, wenn wir größere Konstanz wünschten, mit Hilfe eines Gasmotors erreichten. Wir bliesen unsere Löcher-Reihen durch ein 1 cm dickes Glasrohr an, dessen Mündung sich auf 2 mm verjüngte, und benutzten zur Erzeugung des zum Anblasen nötigen Luft-Quantums zuerst einen Blasebalg; da uns dieser aber recht umständlich war, und wir bemerkten, daß unsere Lunge die nötige Luftmenge und den erforderlichen Druck hergab, bedienten wir uns ferner dieser natürlichen Blasevorrichtung. Das Glas-Ansatzstück steckten wir in einen leicht beweglichen Schlauch, bliesen den Schlauch an und dirigierten mit der Hand die Mündung des Ansatzglases nach der Löcherreihe I oder II. Der eine von uns (Abraham) blies an, bestimmte die Tonhöhe, der andere drehte die Sirene, registrierte die Urteile und verglich zuweilen nach dem ausgesprochenen Urteil mit Harmonium-Tönen. Da die Löcher-Reihen im Verhältnis von 300 zu 500, d. h. 3:5 standen, gaben sie beim Anblasen Töne, welche dieses Schwingungs-Verhältnis zu einander zeigen; d. h. die beiden Töne bilden das Intervall einer Sexte. Um nun möglichst kurze Töne zu prüfen, brauchten wir nur einfach einen Teil der Löcher zu verkleben, d. h. nur eine bestimmte Anzahl anzublasen; wir verklebten nur die Löcherreihe I, während wir Reihe II als Kontrollreihe benutzten und deshalb durch ihre volle Lochanzahl einen kontinuierlichen Ton hervorbrachten. Wir stellten Versuche an mit 20, 10. 5, 3 und 2 Löchern, und da die Lochanzahl, wie wir in der Arbeit bewiesen, mit der Schwingungsanzahl der durch Anblasen entstehenden Töne identisch ist, so experimentierten wir mit Tönen, welche aus 20, 10 u. s. w. bis 2 Schwingungen bestanden. Wir kamen auf diese Weise zu dem sehr interessanten Ergebnis, daß für Töne der Kontra-Oktave bis zur Mitte der viergestrichenen Oktave hinauf zwei Schwingungen genügen, um eine Tonempfindung zu erzeugen. Von der Mitte der viergestrichenen Oktave aufwärts bis zum Ende der fünfgestrichenen Oktave mußten wir mehr Schwingungen zu Gehör bringen, damit eine ordentliche Tonwahrnehmung zu stande kommt, und zwar kamen wir:
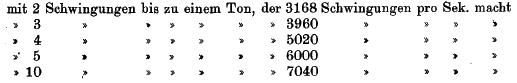
Da wir nun hierbei sehen, daß man bei zunehmender absoluter Schwingungszahl zu Tönen höherer Schwingungsanzahl pro Sekunde gelangt, lag es sehr nahe, die Werte zu betrachten in Bezug auf die absolute Zeit, welche sie ausdrücken. Ein Ton, welcher 3168 Schwingungen pro Sekunde macht, braucht für zwei Schwingungen 2/3l68 = 1/1584 Sekunde oder, setzt man für 1/1000 Sekunde das Symbol a ein, = 0,63 σ. Ein Ton von drei Schwingungen braucht, um eine Tonempfindung zu erzeugen, mindestens 3/3960 = 1/1320 Sekunde = 0,76 σ. Vier Schwingungen brauchen 4/5020 = 1/1255 Sekunde = 0,79 σ, fünf Schwingungen 0,83, zehn Schwingungen 1,42 σ. Man könnte daher sagen, daß für die Tonerzeugung eine Mindestzeit erforderlich ist, welche mit zunehmender Tonhöhe bis 0,63 σ abnimmt, dann bei höheren Tönen wieder wächst.
Nachdem wir in dieser Weise festgestellt hatten, eine wie große Anzahl von Schwingungen und welches Zeitminimum für die Ton-Wahrnehmung erforderlich ist, suchten wir jetzt die zweite Frage zu beantworten, wieviel Schwingungen zur Bildung des absoluten Tonurteils gehören. Es war uns nämlich aufgefallen, daß wir meist eine Wiederholung der kurzen Tonstöße abwarten mußten, um über die absolute Tonhöhe vollkommen im klaren zu sein. Die Tonstöße sind nämlich, wie wir in der Abhandlung auseinander setzten, begleitet von einem knallartigen, tiefen Nebengeräusch, welches sich wahrscheinlich aus Reflexionswellen und unregelmäßigen Nachschwingungen zusammensetzt. Diese Nebengeräusche waren für das Tonurteil sehr störend, und es dauerte eine ganze Zeit, bis wir den kurzen Ton aus dem Konglomerat von Geräuschen, zu welchem sich noch das Anblasegeräusch und das Drehungsgeräusch der Scheibe hinzugesellten, herausschälen konnten; als ich aber mit gespanntester Aufmerksamkeit hinhörte (die Versuche strengten ganz enorm an), gelang es mir, auch bei einem einzelnen Tonstoß, welcher die für die Tonwahrnehmung geringste Schwingungsanzahl hatte, auch das richtige Höhen-Urteil zu fällen, welches allerdings nach einer Wiederholung des Tones bedeutend sicherer wurde. Die Zeit, welche verstrich vom. Beginn der Tonempfindung bis zum Aussprechen des Urteils, war allerdings bei diesen kurzen einmaligen Tonstößen eine sehr bedeutende, ca. 1/2--1 Minute, und wurde durch eine mehrmalige Wiederholung des Tones proportional dieser geringer. Ich bin mir bewußt, während dieser Urteilszeit deutlich den Prozeß des Analysierens durchgemacht zu haben. Ich sonderte im Geiste alle Nebengeräusche aus dem Gehörten heraus und ganz plötzlich, etwa nach einer halben Minute, tauchte in mir das Wortbild eines Tones z. B. as auf; ich verglich dann mit dem Erinnerungsbilde des Tones (as), das ich von früheren Eindrücken her in der Vorstellung habe, und prüfte, ob die Bezeichnung paßte; manchmal pfiff ich mir auch den Ton (as) vor und verglich mit der Tonempfindung, was in Ermüdungsfällen leichter ist, als die Vergleichung mit der Vorstellung. Meist war das aufgetauchte Wortbild das richtige Tonurteil, nur selten mußte ich dasselbe, aber dann auch nur um einen Halbton, korrigieren.
Es zeigte sich also, daß bei einem einmaligen Tonstoß schon richtig geurteilt werden konnte, d. h. daß für das absolute Höhenurteil dieselbe Dauerschwelle maßgebend ist, wie für die einfache Ton-Wahrnehmung. Für die Bestimmtheit des Urteils war aber eine Wiederholung des Tonstoßes sehr wertvoll, und zwar richtete sich die Anzahl der Wiederholungen nach Disposition, Erwartung, Ermüdung und Übung. Unter gewöhnlichen Umständen, wenn die Aufmerksamkeit gerade nicht auf die Tonhöhe gespannt ist, wird eine gewisse Zeit einer Tonempfindung nötig sein, um die Höhe bestimmen zu können, und zwar hängt dies wieder ab von der Klangfarbe, Stärke und Höhe des Tones. So giebt auch v. Kries (1. c.) an, daß, wenn er den Ton einer Lokomotivpfeife einmal kurz erklingen hört, er oft nicht im stände ist, über die Höhe eine Aussage zu machen, und daß ihm dies erst gelingt bei längerem Erklingen oder bei Wiederholung des kurzen Tons.
Von wesentlichem Einfluß auf die absolute Tonhöhen-Bestimmung ist auch die zeitliche Distanz auf einander folgender Töne; es erscheint dies wahrscheinlich unverständlich, da ich oben gesagt habe, daß das absolute Tonbewußtsein mit Intervall-Vergleichung nichts, zu thun habe, es also gleichgültig sei, ob eine Minute oder Tage zwischen zwei Tonempfindungen vergehen. Gewiß ist letzteres richtig; große Zeitdistanzen sind von keinem Einfluß auf absolute Höhen-Bestimmungen, wenn nicht gar durch jahrelangen Mangel jeder musikalischen Beschäftigung das absolute Tonbewußtsein verringert wird. Von Bedeutung für das Höhen-Urteil sind aber die kleinen Zeit-Distanzen zwischen auf einander folgenden Ton-Empfindungen, und diese habe ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. K. L. Schaefer einer genaueren experimentellen Prüfung unterzogen[12]. Wir hatten uns zwei Aufgaben gestellt:
1) Wie rasch können zwei Töne auf einander folgen (d. h. im Triller, oder Tremolo), um noch als zeitlich getrennt empfunden und ihrer absoluten Höhe nach erkannt zu werden,
2) absolute Tonhöhen-Bestimmungen schnell auf einander folgender Töne einer musikalischen Figur.
Beide Aufgaben thun gleichzeitig dar, wie sich auf einander folgende Töne in der Empfindung und im Urteil beeinflussen.
Was zunächst die Versuchs-Anordnung anbetrifft, so war dieselbe ähnlich der für die Untersuchung der kürzesten Töne verwendeten. Die Töne wurden durch Anblasen einer Sirenenscheibe erzeugt, also einer Kreisscheibe, auf der mehrere konzentrische Löcher-Kreise ausgestanzt waren; für die höheren Oktaven benutzten wir die oben beschriebene Aluminium-Scheibe, für die tieferen eine nach demselben Prinzip aus Holz gefertigte, deren Löcher einen etwas größeren Durchmesser hatten. Das Anblasen der einzelnen Löcher-Reihe geschah mittels zweier kleiner Röhren, deren Lichtung genau gleich der Größe der Löcher war. Den Wind lieferte teils ein Kompressions-Apparat, teils wurde mit dem Munde angeblasen. Die Rotation der Scheibe besorgte entweder ein sehr gleichmäßig laufender Motor oder einer von uns, die wir uns darauf eingeübt hatten, mit der Hand. Das Intervall der im Triller oder Tremolo alternierenden Töne ist ohnehin unabhängig von der Schnelligkeit der Drehung. Wenn der eine Kreis z. B. 8n, der andere 9n Löcher hatte, so mußte das Intervall stets eine Sekunde bleiben, wie hoch die Töne und wie rasch ihre Aufeinanderfolge auch sein mochten. Durch Kombination des Kreises von 8n Löchern mit einem andern von 10n Löchern erhielten wir Töne, die im Verhältnis der großen Terz zu einander standen, und ebenso konnten wir auch Quarten- und Quinten-Tremoli herstellen. Dag alternierende Anblasen der Löcher-Reihen durfte nicht etwa so ausgeführt werden, daß der Wind immer erst durch die eine und dann durch die andere Röhre gegen die Scheibe getrieben wurde. Wir ließen vielmehr den Doppelluftstrom kontinuierlich wirken und verklebten oder verstopften dafür abwechselnd gleiche Strecken der beiden Löcher-Kreise. So war zuweilen die erste Hälfte des einen Kreises und die zweite Hälfte des zweiten Kreises mit dickem Papier überzogen. In anderen Fällen wurde der erste und dritte Quadrant des einen Kreises und der zweite und vierte des anderen mit Kork-Stöpseln abgedichtet. Ob die Kreise in Halbkreise, Quadranten, Sextanten oder Oktanten geteilt wurden, richtete sich danach, ob wir höhere oder tiefere Töne erzielen wollten, wir haben im allgemeinen, um Beeinflussungen zu verhüten, beliebig zwischen höheren und tieferen Tonlagen gewechselt.
War die Sirene in der angegebenen Weise vorgerichtet, so begann der Versuch: Wir drehten zunächst die Scheibe ganz langsam und bekamen so tiefe, noch deutlich getrennt zu hörende Töne. Dann ward die Geschwindigkeit allmählich gesteigert, so daß die Töne immer höher und kürzer wurden, bis wir an eine ziemlich scharf bestimmbare Grenze gelangten, bei der die Töne nur eben noch einzeln wahrgenommen werden konnten, beziehungsweise eben anfingen, mit einander zu einem Akkord zu verschmelzen. Jenseits dieses Momentes, der vielleicht als Triller-Schwelle zu bezeichnen wäre, bildeten dann die beiden Töne einen unterbrochenen Akkord, der mit weiterer Beschleunigung der Rotation mehr und mehr an Glätte zunahm. Wir stellten hierauf die Beobachtung auch auf dem umgekehrten Wege an, indem wir vom Akkord ausgehend, den Punkt der eben merklichen Trennung aufsuchten, was sich im allgemeinen als die zweckmäßigere Methode erwies. Jedenfalls wurden stets beide Arten des Experimentes so oft wiederholt, bis wir zu einem klaren Urteil über die Triller-Schwelle und die entsprechenden Höhen der Töne gekommen waren. Alsdann genügte eine einfache Rechnung, um die zugehörige Dauer (d) der Töne zu finden. War nämlich s die Schwingungsanzahl eines derselben, und n die Löcheranzahl des zugehörigen Kreissektors, so mußte d = n/s Sekunden sein. Die Schwingungszahlen wurden wieder für a1 = 440 Schwingungen pro Sekunde genommen. Die Resultate unserer Versuche, welche in der citierten Arbeit tabellarisch aufgeführt sind, möchte ich hier nicht des Näheren auseinander setzen. Im allgemeinen zeigte sich, daß, abgesehen von den höchsten und tiefsten Tonlagen, in denen die zur Erzielung der Triller-Schwelle nötige Zeit ein wenig größer ist, die Schwelle für die mittleren Oktaven fast gleich groß ist, nämlich ca. 1/35 Sekunde pro Ton beträgt für Töne der großen bis zur viergestrichenen Oktave. Es kann also in allen Oktaven gleich schnell getrillert, beziehungsweise tremoliert werden, um gesonderte Ton-Wahrnehmungen hervorzubringen, und zwar macht dabei das Intervall keinen nennenswerten Unterschied. Hervorgehoben zu werden verdient der Umstand, daß in der hohen Region die Dauer-Schwelle im Triller so sehr viel länger ist, als die zur Perzeption eines einzelnen Tones erforderliche (s. o. = 0,63 σ). Eine Erklärung dieses auffallenden Faktums habe ich in meiner an obige anschließenden Abhandlung versucht[13]. Dort habe ich die Gründe klargelegt, welche für die Empfindung und Wahrnehmung in Betracht kommen können. Diese hier näher zu erörtern, dürfte zu weit führen. Was aber hierher gehört und in der citierten Arbeit noch nicht erwähnt ist, das ist der Umstand, daß abgesehen von den für die Empfindung maßgebenden Gründen (Abklingen u. s. w.) für das absolute Tonhöhen-Urteil noch besondere Verhältnisse mit sprechen können, daß zwei auf einander folgende Ton-Empfindungen das Höhen-Urteil störend beeinflussen.
In dem die kürzesten Einzeltöne behandelnden Abschnitt wurde aus einander gesetzt, daß bis zur Fixierung des Urteils eine bestimmte verhältnismäßig große Zeit nötig war, in welcher der Prozeß des Analysierens durchgemacht wird. Dieses Analysieren, sagten wir, wird erleichtert durch Wiederholung eines Tones. Ebenso nun, wie hier die Wiederholung des Tones das Urteil erleichtert, wird in unserem jetzigen Falle, wo es sich bei dem Triller um einen zweiten von dem ersten verschiedenen Ton handelt, das Tonhöhen-Urteil erschwert. Die Aufmerksamkeit wird fortwährend von dem einen zu dem anderen Ton gelenkt und kann nicht so lange bei dem ersten Ton verweilen, um seinen Grundton aus Nebengeräuschen und Klangfarbe zu analysieren. Daß diese Erklärung richtig ist, erhellt daraus, daß bei einer maximalen Triller-Geschwindigkeit, bei welcher die beiden Töne schon zu einem Akkorde verschmolzen, die Tonhöhen-Bestimmung weit leichter war als bei der Schnelligkeit, in welcher die Töne schon getrennt wahrgenommen wurden. Trotz der in ersterem Fall weit größeren Geschwindigkeit und der kurzen Dauer der physikalischen Einzeltöne hatte man doch die Empfindung eines ruhenden Zusammenklangs, der nur etwas rauh war, und konnte so leicht die Tonhöhen des Akkordes bestimmen.
Wir können also sagen, daß absolute Tonhöhen-Bestimmungen bei trillernden und tremolierenden Tönen schon möglich sind, wenn eine gesonderte Wahrnehmung der Einzeltöne wegen der Schnelligkeit noch nicht vorhanden ist, ja daß die Höhen-Bestimmung dann sogar weit leichter zu stande kommt, als an der Trillerschwelle.
Weit wichtiger für die praktische Musik war der zweite Teil unserer Arbeit, in welcher wir die maximale Geschwindigkeit musikalischer Figuren für Empfindung und Höhenurteil in Betracht zogen. Wir machten diese Untersuchungen in Gemeinschaft mit dem jüngst verstorbenen Prof. Oscar Raif von der Königlichen Hochschule für Musik, welcher gleich mir unter gewöhnlichen Umständen ein sicheres absolutes Tonbewußtsein besaß und mit dankenswerter Liebenswürdigkeit uns seine wertvolle Hilfe zu teil werden ließ. Der Versuchsmodus blieb derselbe wie bisher, nur daß eben die Anzahl der aufeinander folgenden Töne vermehrt wurde und jetzt außer auf die absolute Höhe auch noch auf ihre Reihenfolge geachtet werden mußte. Wir haben im ganzen fünf Versuche, angestellt. In den vier ersten bestand die Figur aus vier Tönen, im letzten aus fünf. Bei großer Geschwindigkeit des Scheiben-Umlaufs hörte man nur, daß es sich um eine Mehrheit von nicht völlig gleichzeitigen Tönen handle. Die Beobachter konnten daher die absoluten Tonhöhen größtenteils richtig erkennen (insbesondere die des höchsten und tiefsten Tones) aber nichts oder wenigstens nichts Sicheres über die Reihenfolge aussagen; dieselbe wurde erst bei einer durchschnittlichen Dauer jedes einzelnen Tones von 1/10 Sekunde oder 100 ff erkannt. Eine Wiedergabe der fünf Versuchsprotokolle wird diese Verhältnisse am besten illustrieren:





Beide Versuchs-Personen haben hiernach im großen und ganzen auffallend gleichmäßig geurteilt, fast übereinstimmend richtig und falsch. Bemerkenswert ist, daß die dem musikalischen Ohr ungewohnteren Ton-Kombinationen unrichtiger beurteilt wurden und die Neigung bestand, sie in bekannte umzudeuten. So glaubten die Beobachter z. B. im ersten Versuch statt der wirklichen Töne die ihnen geläufigen Tonfolgen des kleinen Septimen-Akkordes zu hören. Außerdem zeigte sich, wie vorher bei den Triller-Versuchen, daß es schwieriger ist, die absoluten Tonhöhen zu bestimmen, wenn die Töne mäßig schnell nach einander erklingen, als wenn die Töne scheinbar zu einem gebrochenen Akkord vereinigt sind. Es wurden zwar auch dann Fehler gemacht in der Weise, daß einzelne Töne (vgl. Versuch 5) gar nicht gehört wurden. Aber die, welche wahrgenommen wurden, wurden weit schneller erkannt, als bei der mittleren Geschwindigkeit; die Urteils-Zeit war also dann größer. Jedenfalls erwies sich auch aus diesen Versuchen, daß das Tonhöhen-Urteil bei schnell auf einander folgenden Tönen beeinflußt wird von der Zeit-Distanz. Diese Beeinflussung trifft aber auch nur die Analyse des Ton-Komplexes. Ist ein Ton der Figur gehörig analysiert (allerdings gehören dazu zahlreiche Wiederholungen), dann ist für den mit absolutem Tonbewußtsein Begabten auch der Name da; die Association zwischen Ton und Wortbild ist also nicht beeinflußt, sondern nur die Entstehung des deutlichen Tonbildes.
Einen ganz bedeutenden Einfluß hat auf das Urteil absoluter Tonhöhen die Klangfarbe. Derselbe ist so gewaltig, daß viele Musiker Töne einer bestimmten Klangfarbe mit vollkommener Sicherheit benennen können, während sie bei anderm Klang-Charakter ganz im Dunkeln tappen und sich unter einem Ton beliebig ein e oder a oder b vorstellen können. Nach meinen Erfahrungen ist es sogar häufiger, daß das Tonerkennungs-Vermögen auf einzelne Klangfarben beschränkt ist, als daß es auf alle Klänge ausgedehnt ist. Den Begriff »Klangfarbe« müssen wir in ganz spezieller Weise gebrauchen: Gewöhnlich unterscheidet man Klangfarbe im weiteren und engeren Sinne. Der allgemeine Begriff umfaßt nach Stumpf:
1) den Klang-Charakter, der durch associierte Vorstellungen oder Gefühle entsteht,
2) die Tonfarbe einfacher Töne,
3) die durch Obertöne entstehende Klangfarbe,
4) die Klangfarbe, verursacht durch begleitende Nebengeräusche,
5) die durch Stärke und Höhenschwankungen, durch verschiedenes Anund Abklingen hervorgerufene Eigenart.
Was zunächst die associierten Vorstellungen anbetrifft, die einer Ton-Empfindung den Charakter beilegen, so kann sich deren Besprechung hier erübrigen, da sie für die Tonhöhen-Bestimmung hier nicht in Betracht kommen. Wohl kann ein Flötenton die Wort-Vorstellung C hervorrufen und nebenbei als »idyllisch« bezeichnet werden, doch sind beide Begriffe so heterogen, daß sie sich niemals stören oder überhaupt beeinflussen. Weiterhin fällt für unsere Untersuchung der Klang-Charakter aus, den man einfachen Tönen beimißt und der eine Funktion ihrer Hohe ist; zunächst findet man selbst bei physikalischen Instrumenten selten obertonfreie Töne, und dann kämen diese Töne auch nur im Gegensatz zu den obertonhaltigen Klängen in Betracht. Auch von dem durch Höhe- und Stärke-Schwankungen entstehenden Klang-Charakter kann man absehen, weil er die durch Association bedingten Gefühle beeinflußt, nicht das Höhenurteil.
Für uns wichtig ist die Klangfarbe, welche durch verschiedene Beimischung von Obertönen, und welche durch Nebengeräusche entsteht, sie bringt hauptsächlich die Eigenart der Instrumente hervor.
Betrachten wir zunächst, welche Instrumentaltöne am leichtesten in ihrer absoluten Höhe erkannt werden, so steht in erster Linie das Klavier voran. Klaviertöne werden am leichtesten bestimmt, dann die Töne der Geigen, Holzblasinstrumente, Blechinstrumente, Stimmgabeln, Gesangstöne und schließlich die Klänge der Glocken und Gläser. Bei oberflächlichem Anblick dieser Reihe könnte man auf die Vermutung kommen, daß die Instrumententöne, welche am häufigsten gehört werden, auch am leichtesten in ihrer Höhe bestimmt werden. Doch das ist nicht der Fall; denn während allerdings die oft gehörten Klaviertöne weitaus am leichtesten bestimmbar sind, stehen die Töne, welche der menschliche Kehlkopf hervorbringt, und welche an Häufigkeit des Vorkommens wohl mit den Klaviertönen konkurrieren können, an der unteren Grenze der Erkennbarkeits-Skala; mag also auch die Übung in der Klangfarbe von Einfluß auf die Höhen-Bestimmung sein, es muß doch noch ein weiterer Grund hinzukommen, der die Schwierigkeit der Erkennbarkeit von Gesangstönen erklärt. Dieser Grund muß in den Tönen selbst liegen, und da ist das Hauptunterscheidende die Ungleichartigkeit der Obertöne. Es zeigt sich nun, daß nicht etwa die einfachen oder wenigstens die obertonarmen Klänge der Stimmgabeln, sondern gerade die oberton-reicheren, schärferen Instrumentalklänge leicht erkannt werden. Noch wichtiger allerdings als die Anzahl der Obertöne ist die Stärke einzelner Teiltöne für die Höhen-Bestimmung.
Dies sieht man deutlich an den schwer erkennbaren Tönen der Glocken und Gläser und der menschlichen Stimme. Bei Glocken und Gläsertönen sind gerade einzelne Teiltöne so besonders verstärkt in der Klangmasse enthalten, daß der Grundton oft hinter den Obertönen verschwindet, so daß nur durch Aufmerksamkeit und Übung ein Heraushören desselben möglich ist. Bei Gesangstönen kommen noch die unharmonischen Beitöne der Vokale in Betracht, welche einzelnen Beobachtern große Schwierigkeiten machen; so klagt namentlich J. v. Kries, daß er nur in Ausnahmefällen die Töne der menschlichen Stimme und zwar die der Sopranstimme erkennt. Daß Klänge, in welchen einzelne Teiltöne besonders stark hervortreten oder unharmonische Beitöne enthalten sind und den Grundton verdecken, schwer in der Grundton-Höne erkannt werden, erklärt sich also von selbst.
Schwieriger ist es, nachzuweisen, weshalb im allgemeinen obertonreichere Klänge leichter beurteilt werden als oberton-arme. Hier können mehrere von einander ganz verschiedene Möglichkeiten in Betracht kommen. Wenn das, was wir aus den früheren Betrachtungen gewonnen haben, richtig ist, daß nämlich die erste Bedingung für die Höhen-Bestimmung eines Klanges das Heraushören des Grundtones ist, dann müßten obertonlose oder -arme Klänge wie die der Stimmgabeln am leichtesten beurteilt werden. In Wirklichkeit werden diese aber sehr schwer erkannt. Stumpf hat ebenfalls durch Versuche, welche er über die Beurteilung von Intervallen anstellte, gefunden, daß die Analyse bedeutend erleichtert wurde, wenn die Klänge einen schärferen Klang-Charakter hatten, und giebt dafür folgende Erklärung:
Vor allem, wenn Zusammenklänge von scharfen Einzelklängen leichter analysiert werden als von weichen, so läßt sich anführen, daß sehr weiche Klänge der Regel nach zugleich schwach sind. Obertöne kommen eben nur bei Klängen von einer gewissen Stärke des Grundtons zum Vorschein und wachsen an Zahl und Stärke unter sonst gleichen Umständen mit der Stärke des Grundtones, während umgekehrt obertonfreie Klänge, wo sie überhaupt möglich sind, nur bei schwächster Tongebung erzielt werden können, die höchste Oktave ausgenommen.
Stumpf erklärt also die leichte Erkennbarkeit scharfer Klänge durch die größere Stärke des Grundtones, die noch durch die Differenztöne der Obertöne bei zunehmender Stärke des Klanges im Verhältnis mehr wächst als die Teiltöne. Wenngleich es sich bei der Stumpf'schen Erklärung um das Analysieren von Akkorden handelt, läßt sich dieselbe wohl gut auch für das Beurteilen eines Klanges, der ja auch aus Teiltönen besteht, anwenden, wenn anders zu dem Tonurteil überhaupt eine wirkliche Analyse erforderlich ist, was ich gleich näher besprechen werde.
Zweitens kann auch die Übung hierbei von großem Einfluß sein; man analysiert häufiger und darum leichter oberton-reiche als oberton-arme Klänge.
Während diese Erklärungen darlegen, daß das Heraushören des Grundtones bei oberton-reichen Klängen leichter ist als bei milden, kann man auch die leichte Bestimmbarkeit scharfer Klänge in völlig entgegengesetzter Art darthun, muß dann allerdings darauf verzichten, das Heraushören des Grundtons als Conditio sine qua non für die Höhen-Bestimmung zu betrachten. Man kann die Ansicht verteidigen, daß überhaupt nicht der Grundton analysiert wird, ja daß der Grundton überhaupt keine Wort-Vorstellung reproduciert, sondern daß ein ganzer Ton-Komplex, der Grundton zusammen mit einigen Teiltönen erst die Association bewerkstelligt. Das, was wir a0 nennen, wäre dann gar nicht a0, sondern a0 + a1 + e2 + a2 u.s.w. Danach würde sich erklären, weshalb Stimmgabeltöne schwieriger erkannt werden, als schärfere Klänge. J. v. Kries führt eine ähnliche Erklärung an für die leichte Erkennbarkeit der Akkorde. Es handelt sich nach ihm um die wechselseitige Unterstützung verschiedener Associations-Vorgänge, allgemein formuliert darum, daß zwar der Effekt a vorzugsweise an a und der Effekt ß vorzugsweise an b geknüpft ist, gleichwohl a allein durch a nicht hervorgerufen werden kann, sondern nur « und ß zusammen durch a und b. J. v. Kries übersieht nicht die Schwierigkeiten, die sich dieser Ansicht entgegenstellen, hält letztere aber für die am meisten befriedigende Erklärung. Ich glaube, daß dieselbe noch zu modifizieren ist; denn sonst müßte man annehmen, daß die allerschärfsten Klänge am leichtesten erkannt werden, während in Wahrheit in der Obertonzahl nach oben und nach unten hin eine Grenze gezogen ist. Am leichtesten werden Klänge mit mäßig viel Obertönen beurteilt.
Ich stelle mir vor, daß man durch Übung etwa in Klaviertönen den Ton-Komplex, welcher einer Klaviertaste entspricht, als Einheit auffaßt; ein anderer hat sich durch Geigen spiel eine Geigenton-Einheit gebildet, die ihm als Grundeinheit vorschwebt. Klänge, die sehr oberton-reich sind, müssen nun in der Weise analysiert werden, daß aus der Masse die Klavierton-Einheit herausgeschält wird, die vielleicht einen Grundton und zwei Obertöne repräsentiert ;obertonlose Töne müssen erst in der Vorstellung mit den nötigen Obertönen versehen werden, um der Klavierton-Einheit zu entsprechen. Es findet hier allerdings kein bewußtes Hinzufügen von Tönen statt, sondern ein Vergleichen des gehörten obertonlosen Tones mit dem Erinnerungsbilde, das der Ton früher in anderer Klangfarbe (Klavierton-Einheit) im Gedächtnis zurückgelassen hat. Deshalb können nur Beobachter, die sich einen Ton vorstellen können, solche ungewohnte Klänge richtig beurteilen; solche aber, bei denen nur der Name durch die Ton-Empfindung reproduziert wird, sind dazu außer stande. Wir können jetzt also erklären, weshalb sehr scharfe und sehr milde Klänge schwerer beurteilt werden, als mittelscharfe.
Zweitens würde aber die Erklärung nicht etwa der obigen Auffassung, weshalb das scharfe Hervortreten einzelner Teiltöne bei Gläser- und Glockentönen störe, widersprechen. Wir müssen nur allerdings immer dann, wenn wir vom Heraushören des Grundtones sprachen, annehmen, daß nicht der einfache Grundton, sondern die besprochene Einheit gemeint ist. Ob es sich hierbei um eine wirkliche Analyse handelt, ist allerdings zweifelhaft. Eine vollständige Analyse eines Klanges derart, daß der Grundton von der Grundeinheit herausgehört werden und die übrigen Teiltöne einzeln zur Erkennung und Beurteilung kommen, findet bei gewöhnlichen Höhen-Urteilen jedenfalls nicht statt. Aber es ist möglich, daß die Grundeinheit herausgehört wird, und eine bestimmte Summe von Obertönen, und daß diese letztere erst vernachlässigt werden muß, um das Höhen-Urteil zu bilden. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine Reproduktion der Grundeinheit, die sich der Musiker durch Übung gebildet hat. Gewisse Töne, die der Grundeinheit in der Klangfarbe sehr ähneln, reproduzieren sofort diese Einheit, andere, sehr von derselben verschiedene, bringen gar keine Reproduktion hervor, bei wieder anderen gehört eine längere Zeit und Aufmerksamkeit dazu, um die Reproduktion zu ermöglichen.
Ob es sich also um eine Analyse der Klänge oder eine Reproduktion der Grundeinheit handelt, ist schwer zu ermitteln, doch würde dies auch nur ein theoretischer Unterschied sein, für die Praxis kommt eben das nur als feststehend in Betracht, daß bei der Höhen-Beurteilung die Klangfarbe von großer Wichtigkeit ist, da die Klänge erst auf eine bestimmte Grundeinheit bezogen werden. Ob diese Einheit durch Klaviertöne oder sonstige Instrumente gewonnen ist, braucht uns weniger zu interessieren, nur werden durch die Arten der Instrumente große individuelle Schwankungen vorkommen. Daß wir in der That einen aus mehreren Tönen bestehenden Komplex als Einheit, und nicht als Grundton heraushören, scheint auch die oben besprochene Oktaven-Täuschung zu beweisen.
Die Abhängigkeit des Höhen-Urteils von der Klangfarbe zeigt sich bei allen mit absolutem Tonbewußtsein begabten Personen; zwar geben viele an, daß bei ihnen die Klangfarbe in der Erkennung keinen Unterschied macht, das sind aber solche, die eben alle Klänge richtig benennen können. Doch in der Genauigkeit der Beurteilung und speziell in der Urteilszeit kommen erhebliche Differenzen vor. Ich selbst glaubte, daß für mich die Klangfarbe belanglos sei, als ich aber die Tonhöhen-Bestimmungen auf ihre Urteilszeit hin prüfte, fand ich ganz gewaltige Differenzen.
Die Dauer absoluter Tonhöhen-Urteile ist die Zeit, welche vom Beginn der Ton-Empfindung verstreicht bis zum Auftauchen des Buchstaben-Bildes als Laut oder Schriftzeichen oder des Noten- beziehungsweise Tastenbildes, welches dem gehörten Tone entspricht. Nähme man noch die Zeit vom Beginn des physikalischen Tones bis zur Ton-Empfindung hinzu, dann muß man außer der Dauer der Nervenleitung noch die Dauer des Anklingens berücksichtigen. Auerbach und Kries[14] hatten durch Experimente gefunden, daß das Anklingen der tiefen Töne und somit auch die Dauer der Urteilsbildung bei diesen länger sei als bei hohen Tönen. Ich kann dieser Ansicht nicht zustimmen; in unseren Untersuchungen über die maximale Geschwindigkeit von Tonfolgen haben Dr. Schäfer und ich[15] gefunden, daß die Triller-Schwelle für alle Töne ziemlich dieselbe ist, daß mithin das An- und Abklingen auch ziemlich dasselbe sein müsse. Dies zeigte sich, wenn wir die resonanzlosen Töne einer Loch-Sirene zum Versuch verwendeten. Sobald wir aber die Töne eines Klaviers oder eines Saiten-Instrumentes nahmen, änderte sich sofort auch die Zeit des An- und Abklingens, weil die längeren Saiten und die ihnen entsprechenden größeren Resonanz-Räume eine größere Zeit zum physikalischen Mitschwingen gebrauchen, als die kleineren Saiten. Hohe Töne klingen also schneller an und ab als tiefe, aber nur physikalisch, nicht physiologisch. Ein Schluß auf die Urteilsdauer, d.h. auf die Dauer des Existentialurteils, wie ihn v. Kries und Auerbach machen, ist daher nicht gerechtfertigt. Wenn unsere Ansicht, daß die Dauer des Existentialurteils für hohe und tiefe die gleiche sei, richtig ist, dann würden wir sie für die Berechnung der Urteilsdauer absoluter Tonhöhe einfach als Konstante in Abzug bringen können, wenn wir den Moment des physikalischen Tonanfangs fixieren. Die Urteilsdauer absoluter Tonhöhen hängt, wie wir schon verschiedentlich zu bemerken Gelegenheit hatten, von verschiedenen Umständen ab: Wir sahen, daß Töne mittlerer Oktaven weit schneller beurteilt werden, als höchste und tiefste Töne, weil diese im Geiste vielleicht erst in die dem Urteil geläufigen Oktaven umgesetzt werden müssen; wir fanden, daß ganz kurze Töne eine sehr kurze Urteilszeit beanspruchen, hauptsächlich deshalb, weil man sie erst aus ihren Nebengeräuschen aussondern muß; wir sahen ferner, daß Töne mit ungewohnten Klangfarben eine längere Urteilszeit erfordern, als bekannte Klangarten, weil sie entweder in die letztere erst übertragen werden müssen, oder weil man erst die Einheit aus dem Konvolut von Obertönen heraushören muß. So hängt also die Urteilszeit ab von der Höhe, Dauer und Klangfarbe der Töne. Selbstverständlich kommen außer den physikalischen Unterschieden noch rein individuelle Umstände in Betracht, insofern der eine überhaupt schneller urteilt als der andere oder durch die physikalischen Faktoren in verschiedener Weise beeinflußt wird. Eine mittlere Urteilszeit zu berechnen hätte deshalb keinen Zweck, von Interesse wäre nur, die Urteilszeit unter günstigsten physikalischen und individuellen Bedingungen festzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe hat allerdings erhebliche Schwierigkeiten.
Zunächst ist es eine wichtige Frage, wie das Tonurteil fixiert werden soll; man vermag dies durch die Sprache, durch Buchstabenschrift, Notenschrift oder durch Bezeichnung der entsprechenden Taste auf einer Klaviatur oder durch Griff auf einem anderen Instrument. Ich versuchte zunächst unter Mitwirkung von Herrn Dr. Max Meyer die Zeit bis zum Aussprechen des Urteils zu ermitteln. Die Versuchs-Anordnung war dabei folgende: Da Harmonium-Töne leicht und schnell zu beurteilen sind, verwendeten wir solche zu unseren Versuchen und hatten also die Zeit zu messen, welche vergeht vom Beginn des Harmonium-Tones bis zum Aussprechen der Ton-Bezeichnung. Die Harmonium-Tasten wurden angeschlagen mit einer Holzklammer, deren mit Platinblech beschlagene Enden in einen elektrischen Stromkreis eingeschaltet sind. Wird die Taste mit der Klammer angeschlagen, dann werden die Platinbleche auf einander gedrückt, der Strom ist geschlossen; der Strom wird wieder geöffnet durch einen Kontakt, der zwischen den Lippen des Beobachters liegt und beim Sprechen durch eine elastische Feder aus einander geht. Um die Zeit vom Stromschluß bis zum Öffnen zu messen, ist in den Kreis ein Chronoskop eingeschaltet, welches 1/1000 Sekünden zu fixieren im stande ist. Wir glaubten nun, daß es sehr leicht wäre, auf diese Weise die Urteilszeit festzustellen; der Kontakt auf der Klaviatur funktionierte auch sehr gut, weniger aber der Lippenschlüssel; denn erstens wurde der Mund oft früher geöffnet als die Notenbezeichnung ausgesprochen wurde, und zweitens wirkten die verschiedenen Buchstaben so ungleich, je nachdem sie Vokale oder Konsonanten waren, am Lippenthor (bf), am Zungenthor [cd) oder am Gaumenthor (g) hervorgebracht wurden. Da selbst die Übung hierin nichts zu bessern vermocht hätte, gaben wir diese ganze Methode, mit dem Lippenschlüssel zu arbeiten, auf. Das schriftliche Urteil auf seine Zeit zu untersuchen, schien uns deshalb nicht der Mühe wert, weil es immer nur ein mittelbares Urteil, aus Noten- oder Tastenbild entstanden, gewesen wäre.
Ein wahrscheinlich unmittelbares Urteil dagegen fällt man, wenn man die dem gehörten Ton entsprechende Taste auf einer Klaviatur niederdrückt. Die Klaviatur ist dem Klavierspieler so geläufig, daß er, wenn er einen Ton e hört, die Taste e herunterdrücken kann, ohne daß ihm zuerst das Lautbild aufsteigt, und selbst wenn dies der Fall sein sollte, nimmt der Prozeß viel weniger Zeit in Anspruch, als der des Schreibens und vielleicht auch des Sprechens. Wir machten daher jetzt folgende Versuchs-Anwendung. Wieder wurden Harmonium-Töne genommen, wieder wurde die Harmonium-Taste mit dem Klammer-Kontakt angeschlagen, der gleichzeitig den elektrischen Strom schloß; zum Offnen des Stroms bedienten wir uns jetzt eines kleinen selbstkonstruierten Apparates: Ein kleines Klavier, wie es die Kinder als Spielzeug haben, versahen wir an seinen Hämmerchen mit Blechbeschlägen, welche im Ruhezustand gegen eine Blechleiste drückten, die in den elektrischen Stromkreis eingeschaltet war; der Strom ging von dieser Blechleiste durch die Hammerbeschläge weiter. Wurde nun eine Taste heruntergedrückt, so wurde der Hammer von der Leiste entfernt und so der Stromkreis geöffnet.
Wird jetzt also auf einem Harmonium mit dem Klammer-Kontakt ein Ton angeschlagen (z. B. f), und drückt dann die Versuchs-Person den Ton hörend die betreffende Taste f auf dem Kontakt-Klavier nieder, so kann man mittels des eingeschalteten Chronoskops die dafür nötige Zeit bestimmen. Diese Zeit ist allerdings noch nicht die Urteilszeit, sondern sie setzt sich zusammen aus:
1) der Dauer vom Beginn des Stromschlusses bis zum Anfang des phy sikalischen Tones,
2) der Wahrnehmungszeit des Tones,
3) der Urteilszeit der absoluten Tonhöhe in Tasten-Vorstellung,
4) der Zeit des Tasten-Suchens,
5) der Zeit von Niederdrücken der Taste bis zur Stromöffnung.
Die Zeit, welche vom Beginn des Stromschlusses bis zum Beginn des physikalischen Tones vergeht, ist bei den Harmonium-Tönen desselben Registers und bei fortdauernd optimaler Windstärke annähernd dieselbe, um so mehr, als es sich um keine großen Tonhöhen-Differenzen handelte, sondern nur um mittlere Oktaven; so kann jedenfalls das geringe Plus an Zeit, welches die tieferen Töne zur Resonanz verlangen, vernachlässigt werden. Die Wahrnehmungs-Zeit der Töne ist nach unseren oben citierten Untersuchungen für alle Töne dieselbe. Die Zeit, die vergeht vom Niederdrücken der Taste bis zur Strom-Öffnung ist als minimale Konstante nicht in Rechnung zu bringen. Es bleibt also übrig:
1) die Urteilszeit,
2) die Zeit, welche das Suchen der betreffenden Taste erfordert.
Die Zeit des Tasten-Suchens kann eine recht beträchtliche und verschiedene sein, je nach der Differenz der Blickrichtung und der Lage des Versuchstones. Bei unseren kleinen Kontakt-Oktaven hatten wir allerdings nur eine Oktave zu überblicken. Ich bestrebte mich daher, als Versuchs-Person, beim Beginn jedes Versuchs den Blick auf die Mitte der Klaviatur oberhalb der Tasten zu fixieren, um nicht an eine bestimmte Taste zu denken und von beiden Enden der Tastatur gleich weit entfernt zu sein.
Beim Beginn unserer Untersuchungen schlug Dr. Meyer hinter einander Töne aus den verschiedensten Oktaven an; dies erwies sich aber als sehr unzweckmäßig. Denn wenn ich z. B. eben ein d3 beurteilt hatte und dann ein h2 beurteilen sollte, suchte ich unwillkürlich links von der d3-Taste, da ich vom Klavier her es gewohnt bin, die tieferen Töne links zu suchen; ich erinnerte mich dann erst, daß meine Klaviatur nur eine Oktave groß sei. Die Suchzeit war also in solchen Fällen außerordentlich groß und mithin solch Versuch für unsere Frage nicht zu verwerten.
Wir untersuchten deshalb jede Oktave für sich und zwar die kleine, ein-, zwei- und dreigestrichene und je nach der Lage derselben stellte ich mir vor, daß ich mich an einem großen Klavier befände gerade vor der zu beurteilenden Oktave. Die Richtigkeit des Urteils wurde von Dr. Meyer kontrolliert, und zwar zeigte sich kein einziger Fehler in den sämtlichen Versuchsreihen. Die Ergebnisse sind folgende:
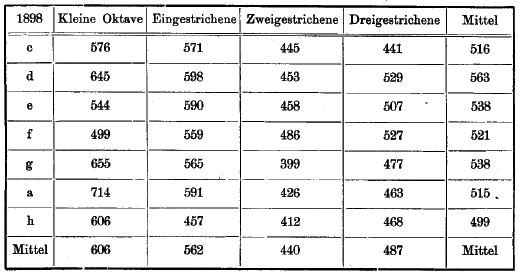
Das interessante Resultat, welches diese Tabelle zeigt, ist, daß für die verschiedenen Oktaven eine ungleiche Zeit erforderlich ist bis zur Fixierung des Urteils durch das Anschlagen der Taste; ich' drücke mich wieder vorsichtig aus und vermeide, Urteilszeit zu sagen, weil die Suchzeit sicher einen beträchtlichen Teil der berechneten Zeit einnimmt. Da wir aber oktavenweise vorwärts gingen und die übrigen oben erwähnten Kautelen anwandten, so glaube ich nicht, daß die Suchzeit von der jeweiligen Oktavenhöhe beeinflußt wird, sondern vielleicht, wenn sie berechnet werden kann, als konstanter Faktor abzuziehen ist. Die Zeit bis zur Fixierung des Urteils ist allerdings bei den einzelnen Tönen der gleichen Oktaven nicht dieselbe, es sind doch im Mittel Schwankungen zwischen 499 und 563, d. h. 64 n Differenz zu verzeichnen. Diese Schwankungen sind wahrscheinlich auf Kosten der Suchzeit zu setzen. Jedenfalls läßt sich aus der Tabelle nicht nachweisen, daß ein bestimmter Ton besonders leicht beurteilt wird dem andern gegenüber, oder daß eine reihenartige Beziehung der einzelnen Töne zu einander bestände. A priori hätte man vielleicht annehmen können, daß der meist beurteilte Ton a etwas bevorzugt würde, aber er nimmt nicht den, ersten Rang der schnellsten Beurteilung ein, sondern auffallenderweise das h. Wenn wir also von den geringen Schwankungen der Suchzeit absehen, dann kommen wir zu dem Schluß, daß die Urteilszeit für absolute Tonhöhen in drei einzelnen Oktaven verschieden ist, am geringsten ist sie bei mir in der zweigestrichenen Oktave und wird nach beiden Richtungen hin größer. Die fixierte Zeit, d. h. die konstante Suchzeit C + der Urteilszeit u ist also:
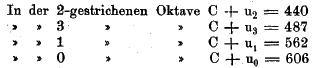
Es wäre nun eine sehr schöne Sache, wenn man die Konstante C herausrechnen und nach ihrem Abzug die reine Urteilszeit herausbekommen könnte. Dies ist uns aber nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie wir dies versuchten, hat uns aber zu so interessanten Ergebnissen geführt, daß sie der Beschreibung wert ist: Wir wollten die Zeit berechnen, die vergeht vom Moment, in dem ein Buchstabe ausgesprochen wird, bis zum Zeitpunkte, in dem die Versuchsperson die dem Buchstaben entsprechende Taste niederdrückt. Dr. Meyer sprach also beispielsweise den Buchstaben C, drückte gleichzeitig den Kontakt mit der Hand zusammen, ich reagierte in derselben Weise wie vorher, d. h. ich drückte die C entsprechende Taste auf dem Kontakt-Klavier nieder. Die Zeiten, welche bei den einzelnen Buchstaben nötig waren, bis zur Tasten-Reaktion sind folgende:
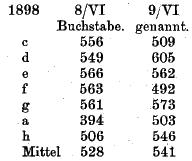
Diese Zahlen sind ebenso groß, wie die oben gefundenen Zahlen, aus denen wir die Urteilszeit bestimmen wollten, ja sie sind noch größer, als die oben ermittelten Ziffern der zwei- und dreigestrichenen Oktave. Wir können deshalb keineswegs diese Zeiten als Suchzeit betrachten und, wie wir es zuerst wollten, von den Höhen-Bestimmungen in Abzug bringen; dann würden wir gar negative Urteilszeiten herausrechnen. Aber wir sind nach unseren Resultaten zu dem Schluß berechtigt, daß der physiologische Übergang von dem gehörten Tonbild zu dem Tastenbild direkt ist und nicht, wie wir dies zuerst annahmen, erst durch das Tonbild ein Buchstabenbild erzeugt wird, welches erst die Tastenvorstellung im Gefolge hat. Ja die Verbindung des Tonbildes mit dem Tastenbilde ist eine innigere als die Verbindung des Tastenbildes mit seinem Buchstaben-bilde.
Die Suchzeit,, die also in beiden Versuchs-Resultaten noch enthalten ist, konnte allein auf diese Weise nicht bestimmt werden; jedenfalls wird sie ein beträchtlicher Faktor unserer Ziffern sein, so daß die absolute Tonhöhen-Bestimmung selbst, d. h. der Übergang vom Tonbild zur Tonbezeichnung (als Tastenbild und auch als Wortbild) nur ganz minimale Zeiten erfordert. Wie wir schon oben sahen, hängt die Urteilszeit von vielen Faktoren ab und ist gemäß Tabelle am kleinsten für mich in der zwei- und dreigestrichenen Oktave. Von großer Wichtigkeit dafür ist wohl die musikalische Übung; ich spiele Klavier und Geige, d. h. Instrumente, in denen die zweiund dreigestrichene Oktave am häufigsten verwendet wird; vielleicht wird der Cellist und Kontrabassist in tieferen Tonlagen schneller urteilen können. Das jedoch glaube ich nicht, daß ich etwa nur die zwei- und dreigestrichene Oktave beurteilen kann und unbewußt die anderen Oktaven auf sie erst beziehe. Dazu sind die Unterschiede in den einzelnen Oktaven zu gering und zu gleichmäßig eigenartig nach der Höhe und Tiefe fortschreitend.
Wir haben jetzt also gesehen, wie die verschiedenen physikalischen Ton-Qualitäten ihren Einfluß auf die Höhen-Beurteilung ausüben, wie es für ein und denselben Beobachter von großer Wichtigkeit ist, welche Höhe, Stärke, Klangfarbe, Dauer u. s. w. der Ton hat. Wir haben hierbei auch schon gesehen, daß es große individuelle Unterschiede giebt, indem der eine unter gleichen Umständen leichter, der andere schwerer die Association zwischen Tonbild und Wortbild bewerkstelligt. Bei allen beschriebenen Versuchen aber fand sich das eine Gleiche, daß, sobald die Grundeinheit des Klanges herausgehört war, beziehungsweise der Klang die Grundeinheit reproduzierte, auch die direkte Association von statten ging. Es waren immer unmittelbare Urteile, die durch die zu beurteilenden Empfindungs-Inhalte bestimmt wurden. Ein Ton wird f genannt, ohne daß der Beobachter sagen kann, warum er ihn f nennt, ohne daß er sich irgend einer Gedanken-Arbeit bei diesem Urteil bewußt ist.
Dies ist aber nicht der einzige Weg, um zu einem richtigen Höhen-Urteil zu gelangen; wie bei anderen Sinnesgebieten giebt es auch mittelbare Wege. Wenn nämlich (Stumpf I, S. 87) heterogene Bewußseins-Momente mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit den zu beurteilenden Inhalten im Bewußtsein koexistieren, so daß a mit a, b mit ß u. s. w. verbunden ist, so entsteht eine Erfahrung dieser Koexistenz, welche weiteren Urteilen zur Grundlage und Richtschnur dienen kann. Das sind dann die mittelbaren Kriterien. So wissen wir beispielsweise, daß sehr hohe Töne außer der Ton-Empfindung einen Schmerz im Ohr hervorrufen. Wenn wir nun durch frühere Versuche erprobt haben, bei welcher Tonhöhe dieser Schmerz empfunden wird, dann können wir mittels eines logischen Schlusses aus der Schmerz-Empfindung, von der ein Ton begleitet ist, seine Tonhöhe folgern. Ebenso soll es Menschen geben, welche beim Hören von Tönen (beziehungsweise Tonarten) bestimmte Farben-Empfindungen haben. Diese könnten aus der Farben-Empfindung die Tonhöhe erschließen. Weiterhin passiert es vielen beim Hören von Tönen, daß sie innerlich mitsingen und aus dem Spannungsgefühl des Kehlkopfes über die Tonhöhe Aussagen machen. Diese Muskel-Bewegung kann automatisch, reflektorisch oder durch Willensakt hervorgerufen sein. Wir haben also ganz verschiedene Arten von mittelbaren Kriterien, welche für Tonhöhen-Bestimmungen verwendet werden können, und zwar sogenannte Mitempfindungen, dann Empfindungen, hervorgebracht durch reflektorische Muskel-Kontraktion, drittens durch bewußten Willen intendierte Bewegungen und Bewegungs-Empfindungen. Schließlich können auch an die Stelle der Empfindungen nur Vorstellungen treten, und dies ist sogar das Häufigere. Auf diese verschiedenen mittelbaren Kriterien möchte ich jetzt des näheren eingehen.
Man hört vielfach die Ansicht aussprechen, daß absolute Höhen-Bestimmungen mit Hilfe des Tongefühls hervorgebracht werden. In Laienkreisen wird mit dem Worte Gefühl bekanntlich viel Unfug getrieben; wenn wir aber unter Gefühlen nur die verschiedenen Grade des Angenehmen verstehen, so läßt sich dieser Begriff leicht in Beziehung auf das Tongebiet untersuchen. Jede Ton-Empfindung wird von einem eigenen Gefühl begleitet. Wir können einen Klang angenehm oder unangenehm nennen. Nun hat sich bekanntlich herausgestellt, daß die angenehme Wirkung eines Klanges größtenteils eine Funktion seiner Klangfarbe ist, welche wieder auf Obertönen und Nebengeräuschen basiert. So können wir denselben Ton (Klang mit einem bestimmten Grundton), von verschiedenen Instrumenten hervorgebracht, einmal angenehm, ein anderes Mal unangenehm nennen. Sehen wir aber von der Klangfarbe ab, d. h. nehmen wir möglichst Töne derselben Klangfarbe, dann ist es mit dem Gefühlsurteil schwach bestellt. Soll man zwei mittlere Töne, etwa c und 6 in Bezug auf die Gefühlswirkung vergleichen, so wird man kaum eine Entscheidung treffen können. Ich könnte nicht einmal sagen, ob mir Töne der großen, kleinen, ein-, zwei- und dreigestrichenen Oktave angenehmer klängen. Jedenfalls glaube ich, daß auch bei Musikern, die dafür ein sehr feines Unterscheidungs-Vermögen besitzen, doch nie solche Schattierungen des Gefühls möglich sind, daß man aus ihnen die Benennungs-Urteile der Töne, die auf Halbtöne genau sein müßten, ableiten könne.
Geht man allerdings noch weiter nach den beiderseitigen Tongrenzen hinaus, dann beginnt der Gefühls-Charakter (auch ohne Änderung der aus Obertönen hergeleiteten Klangfarbe) sich zu ändern, rein aus Gründen der Höhen-Qualität der Töne und der physiologischen Einrichtung unseres Gehör-Apparates: die höchsten Töne erscheinen bekanntlich von einer Schmerz-Empfindung begleitet, wie wenn das Ohr mit einer feinen Nadel gestochen wird[16]. Wenn nun diese Grenze, bei welcher der Ton anfängt schmerzhaft zu werden, bei ein- und demselben Menschen stets dieselbe ist, dann kann bei diesem allerdings das Gefühl ein sicheres Kriterium sein für die absolute Tonhöhen-Erkenntnis, allerdings nur für diesen Grenzton. Da dies aber nur ein Ausnahmefall ist, der bei musikalischen Tönen gar nicht in Betracht kommt (denn die Grenze der Schmerz-Empfindung liegt bei allen Menschen glücklicherweise weit jenseits der Grenze der musikalisch gebrauchten Grundtöne), so möchte ich behaupten, daß das Tongefühl für die Erkenntnis absoluter Tonhöhe belanglos ist. Ähnlich verhält es sich mit der Neben-Empfindung der Rauhigkeit, von weicher die tiefsten Töne begleitet sind. Diese Rauhigkeit entsteht durch Stöße, welche durch die Amplituden der einzelnen Schwingungen erregt werden. Sie verleihen dem Ton einen rauhen und mehr nach der Tiefe zu einen brummenden und schließlich einen flatternden Charakter[17]. Bei den allertiefsten hörbaren Tönen mit einer Schwingungszahl von 16--30 Schwingungen per Sekunde, bei denen man also die einzelnen Stöße zählen, jedenfalls ungefähr schätzen kann, kommt dieses Kriterium wohl in Betracht, und ich glaube, daß die verhältnismäßig guten Urteile, welche ich bei den tiefsten Stimmgabel-Tönen gefällt habe, mit Hilfe dieser Schätzung der Schwingungs-Anzahl gewonnen wurden. Da aber musikalisch, auch dieser Grenzfall nicht in Betracht kommt, so ist er auch nur von theoretischem Interesse. Dieses Kriterium würde auch nicht in die reine Gefühls-Sphäre hineingehören; denn die Empfindung der Rauhigkeit ist kein Gefühl, sondern eine Empfindung, die allerdings wie jede Empfindung von einem Gefühl begleitet ist; ob dies aber in unserem Falle das Kriterium bietet, ist zweifelhaft. Nach neuesten Annahmen scheint es sicher, daß es der Tastsinn des Trommelfells selbst ist, welcher die Stöße empfindet.
Schließlich darf ein dritter Ausnahmefall nicht unerwähnt bleiben: Unser Trommelfell hat einen Eigenton, der wohl bei den. verschiedenen. Menschen variiert, aber meist auf fis2 angegeben wird. Ertönt nun ein fis2, so wird das Trommelfell in Resonanz versetzt, der Ton wird also anderen Tönen gegenüber verstärkt und kann daran erkannt werden. Das wäre eine Ableitung eines Tonhöhen-Urteils aus einer Intensitäts-Empfindung.
Alle diese mittleren Kriterien, das Tongefühl, die Schmerz-Empfindung, die Rauhigkeits-Empfindung und Intensitäts-Empfindung, die also nur in Ausnahmefällen für Höhen-Urteil von Belang sein können, sind immer noch mittels unseres Gehör-Apparates gewonnen. Doch das Gewöhnliche ist, daß mittelbare Kriterien aus anderen Sinnes-Gebieten herangezogen werden, um ein absolutes Höhen-Urteil zu fällen.
So giebt es eine aweite Weise, in der die mittelbaren Kriterien wirken können, und zwar derart, daß reflektorisch automatisch durch die eine Vorstellung eine zweite erregt wird und diese dann erst wieder eine dritte im Gefolge hat. So habe ich zahlreiche Beispiele gefunden, bei denen der Gesichtssinn zu Hilfe genommen wird, um ein Höhen-Urteil zu bilden. Wenn der Ton a erklingt, wird bei manchem erst das Notenbild a, bei einem anderen das Tastenbild reproduziert und erst durch dieses das Buchstabenbild. In dieses Gebiet gehört auch die so viel besprochene Audition coloree. Schon seit langer Zeit weiß man, daß durch Reizung eines Sinnesnerven außer der diesem zugehörigen Empfindung noch gelegentlich sogenannte Mitempfindungen entstehen können in anderen Nerven, ja in anderen Sinnesgebieten. Ebenso wie der Nervenprozeß von sensiblen Nerven auf motorische Nerven übergehen und einen Reflex zu stande bringt, ebenso wie er von motorischen auf andere motorische Nerven übergeleitet werden kann und eine Mitbewegung im Gefolge hat, so kann auch die Reizung eines sensiblen Nerven sich fortsetzen auf andere sensible Nerven auch im Gebiete anderer Sinnes-Modalitäten. So kann ein Schallreiz optische Empfindungen hervorrufen. Bleurer und Lehmann haben im Jahre 1881 diese Verhältnisse in ihrem Werke „Zwangsmäßige Lichtempfindungen durch Schall" genauer studiert.
Die Personen, welche wirkliche Farben-Empfindungen beim Hören von Tönen haben, sind allerdings recht dünn gesät. : Viel zahlreicher sind diejenigen, welchen bei akustischen Reizen eine Farben-Vorstellung auftaucht. Ob dies nur eine schwächere Form der Association ist, wie Hennig[18] meint, oder ein von der wirklichen Mitempfindung verschiedener Prozeß, möchte ich dahingestellt sein lassen; Hennig unterscheidet physiologische und psychologische Synopsien. Unter den ersteren versteht er solche, welche durch physiologische Prozesse bedingt sind und im eigentlichsten Sinne des Wortes »zwangsmäßig« sind, so daß sie auch ohne Zuthun der Überlegung zu stande kommen würden, unter den psychologischen solche, welche durch eine urteilsmäßig entstandene, aber sehr enge und untrennbare Verknüpfung einer Farben-Vorstellung mit einem nicht visuellen Begriff bedingt werden. Ich möchte, wenn sich überhaupt diese Einteilung durchführen ließe, meinen, daß ein großer Teil der sogenannten physiologischen Synopsien doch in das Gebiet der psychologischen.überwandern müßten. So z. B. die Farben-Vorstellungen, welche die Vokale hervorrufen. Hennig meint, daß sie eine direkte Funktion der Klangart (der Obertöne u. s. w.) seien. An mir selbst dagegen habe ich gefunden, daß da noch weite und komplizierte Mittelwege vorhanden sind. Auch ich stelle mir die Vokale farbig vor und zwar:
| a | e | o | ö | i | ü | u |
| weiß | gelb | rot | orange | ? | grün | schwarz |
Möglich ist nun, daß die Farben-Vorstellung weiß und schwarz bei a und u bedingt sind durch die Klangfarbe der Vokale direkt, die übrigen Vokale sind aber sicherlich in meiner Vorstellung deshalb gelb, grün und rot, weil im Worte gelb ein e, in rot ein o, in grün ein ü vorhanden sind; vielleicht ist auch das u durch das Wort »dunkel« zu erklären. Sicherlich sind hierbei ganz komplizierte Associationen mitwirkend, und wie bei mir wird es bei vielen sein. Jedenfalls kann man dies unmöglich noch Mitempfindung nennen; es soll aber vorkommen, daß ein Mensch beim Hören bestimmter Töne eine Farben-Empfindung oder sehr intensive Farben-Vorstellung bekommt, an deren Auftauchen er den Ton erkennen könnte. Leider aber sind die Litteratur-Angaben über solche Individuen nicht nur spärlich, sondern auch unklar und widerspruchhaltig. So beschreibt Flournoy die Farben-Vorstellung des Prof. Cart. Letzterer schreibt:
Les couleurs correspondant aux tons musicaux (ut = blanc, mi = rouge, la bemol = bleu-violet) m'apparaissent comme inseparables du ton et en idee abstraite, et ä la perception sensuelle. Quand j'entends jouer en do majeur, je vois blanc lumineux; peu de couleur, mais beaucoup de lumiere.
Aber später erklärt Prof. Cart, daß er die Tonart nicht am Farbenbild erkennen kann, aus Mangel an musikalischer Bildung seines Ohres. -- Hennig selbst schildert ebenfalls einen sehr interessanten Fall, in dem eine Dame, die bei den übrigen Tonarten keinerlei Photismen hatte, bei Des-dur die Empfindung von rotem Sammet hatte und ein andermal an dieser Empfindung das Des-dur erkannte. Leider war er nicht im stände, größere Versuchsreihen mit dieser Beobachterin anzustellen.
Ich habe nun in meinem Fragebogen mich ebenfalls nach der Audition coloree erkundigt und habe nur Fälle von Farben-Vorstellungen, nicht Empfindungen ermitteln können, und zwar 9, in denen die Tonarten Farben-Vorstellungen wachriefen, einen Fall, in dem sie Vorstellungs-Schattierungen von hell und dunkel auslösten, einen Fall, in dem nur bestimmte Stellen in Musikstücken mit Farben-Empfindungen associiert waren. Die Fälle folgen in nachstehender Tabelle.
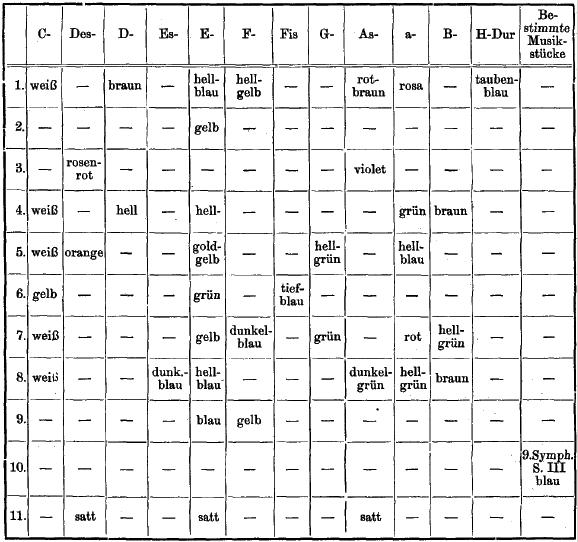
Diese Farben-Vorstellungen werden teils reflektorisch erregt beim Hören von Musikwerken, teils kommen sie beim Musikhören gar nicht in Betracht und werden nur auf Befragen ermittelt. Da können denn allerdings alle möglichen Faktoren noch in Betracht kommen. Fast alle nennen C-dur weiß, wahrscheinlich wegen der weißen Tasten, die zumeist in der Tonart verwendet werden. Ein Beobachter nannte den Charakter von C-dur gelb, möglicherweise, weil sein Klavier etwas alt ist, so daß das Elfenbein der Tasten allmählich eine gelbe Farbe angenommen hat. Ich bin nicht im stande, alle Farben-Urteile der Tonarten so zu erklären, glaube aber, daß für viele derselben ein außermusikalischer Gedankenkreis die Geburtsstätte war.
Für das absolute Tonbewußtsein jedenfalls war in keinem Falle die Farben-Vorstellung zu verwerten. Selbst wenn das Anhören eines Tonwerkes reflektorisch eine Farben-Vorstellung auslöste, hat doch keiner der Beobachter aus der Farbe die Tonhöhe erschlossen, sondern das Höhen-Urteil war da, und in manchen Fällen trat als koordiniert noch die Farben-Vorstellung hinzu. Nach meinen Erfahrungen ist somit die Audition coloree nicht im stande, ein mittelbares Kriterium für Höhen-Urteile zu bieten.
In dieses Gebiet gehört auch die Frage, ob es ein absolutes Tonarten-Bewußtsein giebt, welches nicht auf einem absoluten Tonbewußtsein basiert. Die Angelegenheit ist in den letzten Jahrzehnten pro et contra erörtert worden. Daß ein mit absolutem Tonbewußtsein begabter Musiker sofort auch jede Tonart bezeichnen kann, ist, wenn er die Anfangsgründe der Musik kennt, selbstverständlich. Wir sahen aber, daß es auch Menschen mit partiellem Tonbewußtsein giebt, solche, die nur einzelne Töne bestimmen und sich vorstellen können, andere nicht. Für diese ist es bedeutend leichter, Tonarten zu erkennen, als einzelne Töne; denn in einem Akkorde oder in einer Tonfolge ist die Wahrscheinlichkeit, daß die bekannten Töne vorkommen, größer als bei Einzeltönen. Die bekannten Töne dienen dann als Stützpunkte, aus denen mit Hilfe des Intervall-Sinns die Tonart erschlossen wird. Von den 100 Beantwortern meines Fragebogens erklärten 18, daß es ihnen weit leichter wäre, eine Tonart zu erkennen, als einen einzelnen Ton; alle diese hatten aber ein partielles absolutes Tonbewußtsein.
Ist es nun denkbar, daß ein Mensch, der keine Spur von absolutem Tonbewußtsein besitzt, dennoch mit Sicherheit Tonarten zu bestimmen vermag?
Diese Frage ist bisher immer mit der Erörterung der Tonarten-Charakteristik vermengt worden und ist daher durch Phantastereien und subjektive Anschauungen verzerrt und weder theoretisch noch praktisch gelöst worden. Es ist zwar unmöglich, das eventuelle Tonarten-Bewußtsein ganz von der Tonarten-Charakteristik zu trennen, da es ja eine Folge derselben sein soll, doch ist der Begriff der Charakteristik sehr groß und nur ein minimaler Teil desselben die Ursache des eventuellen Tonarten-Bewußtseins, sodaß man die einzelnen Teile streng scheiden muß, wenn man Klarheit darüber haben will. Das neueste Buch, in welchem die einzelnen Punkte eingehend erörtert worden sind, datiert vom Jahre 1897 -- Hennig, »Die Charakteristik der Tonarten». In dieser Schrift ist eine erschöpfende Litteratur-Angabe zu finden. Ich werde die Abhandlung noch oft berühren, sobald ich erst die Dispositionen des hierher Gehörigen genügend präcisiert habe.
Es ist Thatsache, daß ein Komponist für ein Werk eine Tonart wählt, welche ihm besonders zusagend erscheint; ich drücke mich absichtlich so unbestimmt aus, denn die Wahl der Tonart kann alle möglichen Ursachen haben und braucht nicht durch den Charakter der Tonart bedingt zu sein.
1) Zunächst kann dem Komponisten die gewählte Tonart besonders geläufig und bequem sein in technischer und harmonischer Hinsicht. Mancher phantasiert auf dem Klavier in g- und d-dur ausgezeichnet; die Übung hat ihm die Eingangspforte der Modulation von dieser Tonart in viele andere eröffnet. Sollte er in fis- oder cis-dur dasselbe phantasieren, so würde er gar bald in die Brüche kommen, teils wegen instrumenteller Schwierigkeiten, teils wegen Ungeübtheit in den Harmonien. Die Wahl der Tonart hat hier also nur subjektive Gründe, die nicht mit dem Charakter der Tonart zusammenhängen. Es mag dies allerdings nur bei Komponisten zweiten Ranges in Betracht kommen; doch kein Meister ist vom Himmel gefallen, und in der Jugend empfindet wohl jeder Komponist seine harmonischen und technischen Schwierigkeiten. Dann wählt er seine ihm geläufigen Tonarten für seine Komposition. Diese bleiben oft seine Lieblings-Tonarten, welche er auch noch nach Jahren, wenn die Schwierigkeiten, die ihm andere Tonarten bieten, fortgefallen sind, doch noch bevorzugt.
2) kommt es vor, daß ein Komponist ein möglichst schwieriges Stück für Virtuosen schreiben will und durch die Wahl der Tonart die Schwierigkeiten erhöhen will. Glücklicherweise hat dieser Grund, der für Etüden zwar seine Berechtigung hat, für andere Kompositionen aber lächerlich wäre, keine große Bedeutung, und ich erwähne ihn auch nur, weil er mehrfach bedeutungsvoll citiert wurde. Den zuerst angeführten Grund, dem ich dagegen eine große Wichtigkeit beimesse, habe ich nirgends erörtert gefunden.
3) wählt der Komponist die Tonart, weil sie ihm mit dem Charakter der zu schreibenden Komposition oder mit seiner augenblicklichen Ge müts-Stimmung am besten übereinzustimmen scheint. So findet man vielfach für etwas einfach Heiteres die Tonart c- oder g-dur, für be sonders ernste düstere Stimmung es-moll. Ich will gleich bemerken, daß ich mich auf eine psychologische Untersuchung des Dur- und Moll-Charakters nicht weiter einlassen werde, weil sie mit unserem Thema gar nichts weiter zu thun haben; ich verstehe es daher auch nicht, daß Hennig sagen kann, die eine Dur-Tonart habe einen stärkeren Moll-Charakter als eine andere Dur-Tonart. Für mich haben alle Dur-Tonarten denselben Dur- Charakter, der Intensitäts-Schwankungen überhaupt nicht unterliegt. Für unsere Fragen sind die Dur-Tonarten von den Moll-Tonarten völlig gesondert zu betrachten und nur unter sich zu vergleichen.
Wir müssen unsere Frage jetzt so formulieren: Aus welchen Gründen wählt der Komponist bei bestimmten Gemüts-Stimmungen bestimmte Tonarten?
A) Die Gründe können rein konventioneller Natur sein. Der Komponist wählt, um etwas Gewaltiges, Kraftvolles auszudrücken, beispielsweise d-moll, weil er viele Musikwerke kennt, in denen d-moll bei gewaltiger, kraftvoller Musik verwendet ist, so daß sich in ihm bereits eine Gedanken-Verbindung zwischen d-moll und gewaltig gebildet hat. Noch stärker ist dieser Einfluß bei Programm-Musik. Will der Komponist die Gefühle, die eine klare Mondnacht in uns erweckt, musikalisch schildern, so wählt er vielleicht fis-moll, weil andere Mondschein-Kompositionen diese Tonart zeigen: Mendelsohn's Komposition von Lenau's Schilflied, Schumann's Mondnacht (Eichen-dorff), welches allerdings in e-dur geschrieben ist, aber zahlreiche fis-moll-Stellen aufweist. Ein anderer Komponist wählt für seine Mondnacht vielleicht cis-mott, weil die Beethoven'sche cis-moll-Sonate, die sogenannte Mondscheinsonate (übrigens von Beethoven selbst nicht so bezeichnet) in ihm die Association zwischen cis-moll und Mondschein gebahnt hat. Das Musikwerk, das die Ursache für die Wahl der Tonart abgiebt, braucht übrigens dem Komponisten nicht im Bewußtsein aufzutauchen. Die Bahnüng der Association ist schon so fest, daß die Zwischenglieder entbehrt werden. Daß diese Zwischenglieder meist vergessen sind, ist der Grund, daß so viel phantastische Erklärungen der Tonarten-Wahl gegeben worden sind; daß aber viele Komponisten bei genügender Selbstbeobachtung angeben können, durch welche Tonstücke sie zu ihrer Charakter-Auffassung der Tonart gelangt sind und somit zur Wahl für ihre Komposition, das ist ein Beweis, daß der Konvention ein mächtiger Einfluß in unserer Trage beizumessen ist. Selbst Hennig, der den Einfluß der Konvention sehr gering anschlägt, giebt im II. Teil seiner Abhandlung Urteile seiner eigenen Versuchspersonen an, welche durch Konvention entstanden sind (Dr. Michaelis, Prof. v. Kries, Prof. Cart).
Möglich ist auch, daß die Konvention nicht nur ontogenetische, sondern auch phylogenetische Folgen haben kann, derart, daß eine Associations-Bahnung anatomische Veränderungen bewirkt, die vererbbar sind; so scheint Billroth[19] die ganze Harmonien-Entwickelung aufzufassen.
Gegen die Konvention als Ursache der Tonarten-Wahl könnte jemand einwenden, daß dadurch einfach die ganze Frage nur verschoben, nicht gelöst wäre. Denn gesetzt, ein Komponist wählt zu einem Mondlied fis-moll, weil ihm Schumann's Mondnacht bewußt oder unbewußt im Gedächtnis wirksam ist, weshalb hat denn Schumann fis-moll gewählt, und wurde auch er durch die Konvention beeinflußt, weshalb denn der Komponist, der zuerst bei einem Mondliede fis-moll anwandte? Darauf wäre zu antworten, daß einmal die Konvention nicht der alleinige Grund der Tonarten-Wahl ist, wie wir gleich sehen werden; dann aber ist mit dem Verschieben der Ursache in die Vergangenheit schon viel gewonnen, weil da wohl hauptsächlich technische Gründe, wegen der Unvollkommenheiten der Instrumente in früherer Zeit, ins Gewicht fallen. Zunächst aber müssen wir außer den Associationen, die durch Konvention entstanden sind, noch solche erwähnen, deren Ursache schwieriger zu eruieren ist; es sind diese mehr äußerlicher Art. Sie nehmen von der Vorzeichnung und Benennung der Tonarten ihren Ursprung.
B) Es ist nicht zu leugnen, daß ein Unterschied besteht zwischen fis-dur und ges-dur; selbst auf dem Klavier, auf dem doch beide Tonarten identisch sind, scheinen dieselben einen verschiedenen Charakter zu haben, je nachdem man sich fis-dur oder ges-dur vorstellt. Also kann der Unterschied des Charakters nur bedingt sein entweder durch die Vorzeichen oder durch die Namen der Tonart. Die Wirkung der Vorzeichen würde sich herleiten aus der Raumsymbolik der Töne; dadurch, daß wir die Töne, welche viele Schwingungen in der Zeiteinheit machen, hoch nennen, haben alle mit Kreuzen versehenen Tonarten den Charakter des Erhöhten, des Spitzen (wir nennen ja hohe Töne auch spitz). Umgekehrt haben die mit B's versehenen Tonarten den entgegengesetzten Charakter, sie erscheinen weich, mild und, da man tiefere Töne leicht mit dunkel associiert, dunkler als die mit Kreuzen versehenen Tonarten. Galley schreibt in seinem musikalischen Konversations-Lexikon:
Im Allgemeinen haben die durch B, also durch Herabsetzung, Erniedrigung entstehenden Tonarten den Charakter des Traurigen, Herabgestimmten; dagegen ist den Kreuztonarten, duroh Erhöhung entstandenen, auch der heitere, fröhliche Charakter, die höher potenzierte Stimmung eigen.
Wie groß der Einfluß dieser Association ist, kann nur schwer bestimmt werden, er ist aber sicherlich vorhanden, ebenso wie auch die Benennung (das gesprochene Wort) der Tonart eine Wirkung auf den Tonarten-Charakter oder besser auf die Charakterisierung der Tonart haben kann. Die Wörter fis, eis, gis u. s. w. haben einen spitzen Klang; dieses Spitze überträgt man dann unwillkürlich auf die Tonarten, bei welchen diese fis, cis, gis Grundtöne sind, welche also schon in ihrem Namen das Spitze enthalten. Daher mag es kommen, daß fis-dur, fis-moll u. s. w. so oft für scharf und spitz klingend erklärt werden. Daß diese Begriff-Übertragung vom Wort auf den Tonarten-Charakter thatsächlich nicht ganz bedeutungslos ist, habe ich an mir selbst erfahren. Als ich meine Untersuchungen in den höchsten Ton-Regionen anstellte, in welchen mir ein Höhen-Urteil nicht mehr gelingt, schienen mir alle diese hohen spitzen Pfeiftöne fis oder eis oder gis zu sein (s. o.). Sowie der Ton erklang, tauchte in mir solch Wortbegriff eis u. s. w. auf; ich probierte dann herum, ob diese Bezeichnung wohl die dem Ton entsprechende sein konnte, merkte aber bald, daß es nur eine Täuschung war, die durch die spitze Klangfarbe des Tones und der Bezeichnung eis entstanden war.
Auch vom Gesichtssinn her können noch Urteils-Kriterien über den Tonarten-Charakter ihren Ursprung nehmen. Die weißen Tasten mögen ihrer Helligkeit wegen diese Helligkeit auch ihren Tönen mitteilen, die den dunklen Tasten entsprechenden Töne werden als dunkel beurteilt, und danach die Tonarten, in denen viel weiße Tasten vorkommen (c-, g-, f-dur), als hell, die mit viel Obertasten (as, des u. s. w.) als dunkel.
Alle diese Charakterisierungen der Tonarten sind also, wie wir sehen, durch Konvention oder Association entstanden, die individuell sind und jedenfalls nicht autochthon als Folgen eines »Toncharakters« entstanden. Sie werden auch meistens nur ausgesprochen, wenn nach dem Charakter einer betreffenden Tonart gefragt wird; die Urteile versagen meistens, wenn der Beobachter, ohne das Klavier zu sehen und die Tonarten-Benennung zu wissen, gespielte Akkorde charakterisieren soll. Da kommen dann wieder andere Gründe in Betracht, die das Urteil beeinflussen können, die aber auch noch nicht das Recht geben, von einem lediglich der Tonart anhaftenden Charakter zu sprechen.
C) Es sind das physikalische Gründe, die durch die instrumentelle Beschaffenheit bedingt sind:
a) Wir wissen, daß die weißen Tasten auf dem Klavier einen lauteren, helleren Klang geben, als die schwarzen Tasten, teils wie schon Helmholtz[20] angegeben hat, weil beim Niederdrücken der weißen Tasten eine kräftigere Hebelwirkung entfaltet wird, teils aber auch wohl, weil bei den weißen Tasten, da sie bedeutend mehr gespielt sind, als die schwarzen, die Dämpfung des Hammers sehr bald unverhältnismäßig vermindert wird. Demnach erscheinen Tonarten, in denen viele weiße Tasten vorkommen und besonders der Grund ton einer weißen Taste entspricht, heller als die anderen Tonarten.
b) Die leeren Saiten der Streichinstrumente g d a e sind oberton-reicher und klingen daher heller als die übrigen Töne der Geigen, somit geben auch sie den Tonarten, in denen sie viel verwendet werden, speziell denen, in welchen sie die Grundtöne sind, einen helleren Charakter.
c) Die Naturtöne der Blasinstrumente klingen ebenfalls heller, als die durch Griffe und Stopfen erzeugten Töne. Nach diesen Gesichtspunkten müßte auf dem Klavier c-dur am hellsten, auf Geigeninstrumenten g-, d-, a-, e-dur, auf Blasinstrumenten es-dur (als Naturton der meisten Blasinstru mente) besonders hell klingen. Daß diese Ursachen stark ins Gewicht fallen, erhellt schon daraus, daß das es-dur eines Blasorchesters ungleich heller und schärfer wirkt, als das es-dur eines Streichorchesters oder Klaviers. -- Die physikalischen Unterschiede der Instrumentation sind also von bedeutendem Einfluß auf ein Tonurteil; sie können auch dem Gedächtnis derart einverleibt werden, daß sie die Charakterisierung der Tonart, auch wenn sie nicht gerade gehört wird, bestimmen; bei dem einen bestimmen sie vielleicht allein das Charakter-Urteil, bei einem anderen wirkt vor allem die Konvention, ein dritter formiert sein Urteil aus den eben besprochenen Associationen.
d) Das Häufigste aber ist wahrscheinlich, daß nicht der eine oder der andere Faktor das Urteil bestimmt, sondern daß sämtliche oder mehrere Mo mente zusammen wirken in einer procentualischen Zusammensetzung, die niemals zu eruieren ist, in jedem einzelnen Falle verschieden ist und ganz von der augenblicklichen Disposition des Beobachters abhängt. Manchmal verbinden sich die Komponenten des Urteils zu einer Verstärkung desselben, manchmal schwächen sie sich ab. So kann mir z. B. ein c-dur-Akkord einen hellen, frischen, freudigen Eindruck machen 1) wegen der starken Hebelwirkung der weißen Tasten, 2) wegen der schwächeren Hammerbefilzung der weißen Tasten, 3) wegen der weißen hellen Farbe der Tasten, 4) weil ich an ein Kinderlied erinnert werde, das auch in c-dur geschrieben ist, dessen Melodie mir etwas Unschuldvolles, Reines auszudrücken scheint, wobei dann wieder das Wort »rein« sich mit den Begriffen »klar« und »hell« verbindet und so potenzierend auf den Tonarten-Charakter übertragen wird.
Noch ein Beispiel: fis-moll soll beurteilt werden: 1) das Wort fis klingt scharf und spitz, dies überträgt sich auf die Tonart. 2) Der Tonart fis-moll sind Kreuze vorgezeichnet, diese verleihen ihr einen erhöhten spitzen Charakter. 3} Mit einem Male taucht Schumann's Mondnacht in meinem Gedächtnisse auf, in dem fis-moll verwendet ist, und sofort erscheint die Tonart weich und milde. Will man nun diesen Begriff spitz und weich und milde zu einem Charakter vereinigen, dann kann es kommen, daß man, wie Hennig, den Charakter von fis-moll »auffallend spitz«, unangenehm gellend nennt und ihn vergleicht mit einem »eigentümlich flimmernden fahlen Lichtschimmer«.
Ich glaube deshalb, daß man von allen Charakter-Bestimmungen von Tonarten frei aus dem Gedächtnis absehen muß und nur Urteile registrieren soll, die direkt nach der Empfindung formiert werden, dann vermeidet man wenigstens die ersteren Kriterien, die associativen. Selbstverständlich darf man, um Charakter-Urteile in der Tonart zu erlangen, nicht verschiedene Musikstücke, ja auch nicht einmal dasselbe Musikstück wählen, sondern nur Akkorde, weil erfahrungsgemäß der Charakter des Musikstücks das Charakter-Urteil der Tonart weit mehr beeinflußt, als umgekehrt. Verfährt man in dieser Weise, dann wird man vielleicht manchmal finden, daß ein Beobachter mit strenger Aufmerksamkeit aus den physikalischen Tonuntergchieden sich ein so festes Charakterbild formiert, daß er daraus ein Tonhöhen-Bild machen kann. Hört ein Beobachter viel Klavier spielen, dann lernt er bald die Töne der weißen von denen der schwarzen Tasten unterscheiden, Und wenn er mehrere Akkorde hört, in denen nur weiße Tasten gespielt werden, so erschließt er daraus c-dur, ein anderer erkennt g-, d-, a-, e-dur am Streichinstrument, ein dritter es-dur bei den Bläsern.
Das alles aber kann man noch nicht absolutes Tonarten-Bewußtsein nennen, das Tonarten-Bewußtsein soll ja eine Wirkung der Tonart sein und nicht der physikalischen Klangfarben-Unterschiede einzelner Instrumental-Töne. Will man also ermitteln, ob solch ein Tonarten-Bewußtsein in der Art wie das absolute Tonbewußtsein wirklich existiert, dann ist es nötig, auch die physikalischen Tonunterschiede möglichst gänzlich zu eliminieren. Dies ist bisher noch nirgends geschehen. Hennig, welcher in seinem Buch fast alle physikalischen und subjektiven Gründe, die ich genannt, bespricht, zieht leider nicht die logische und praktische Konsequenz aus seinen Ausführungen. Er behauptet, selbst, ohne eine Spur von absolutem Tonbewußtsein zu besitzen, im stande zu sein, Tonarten rein an ihrem Charakter zu erkennen, unbeeinflußt von subjektiven Momenten oder physikalischen instrumentellen Faktoren. Er giebt aber meist Beispiele an, in denen er die Tonart von Musikstücken von Klavier oder Orchester gespielt erkannt hat und nur minimale Beispiele aphoristisch zerstreut für das Tonarten-Urteil von Akkorden.
Ich glaube nun, eine Methode gefunden zu haben, mit der man Versuche anstellen kann, unbeeinflußt von den störenden Faktoren: Wenn man einen Akkord mit einem Phonographen aufnimmt, dann kann er in derselben Tonarten-Höhe reproduziert werden, wenn nämlich die Drehgeschwindigkeit der Phonographen-Walze bei der Aufnahme wie bei der Wiedergabe dieselbe ist. Variiert man dagegen die Geschwindigkeit, dann variiert man auch die Tonhöhe. Durch die Güte des Kuratoriums der Gräfin Louise Bose-Stiftung ist mir für akustische Untersuchungen ein Edison'scher Phonograph bester Qualität zur Verfügung gestellt worden. Die Walze desselben wird durch einen Elektromotor getrieben und kann durch eine Brems-Einrichtung beliebig schnell und langsam gedreht werden. Wenn ich z. B. a1 = 440 Schwingungen pro Sekunde auf meinem Phonographen aufnehme und bei der Wiedergabe nur die halbe Rotations-Geschwindigkeit anwende, so entsteht nicht der Ton a1, sondern, da jetzt in der Sekunde nur 220 Schwingungen zur Tonproduktion verwendet werden, der Ton a0, die tiefere Oktave. So bin ich mit meinem Phonographen im stande, im Umfang von l1/2 Oktaven den aufgenommenen Ton beliebig zu vertiefen oder zu erhöhen. Hat nun dieser Ton z. B. wieder das a, das durch eine leere a-Saite der Geige hervorgebracht sei, einen besonders hellen Charakter, an dem er vor anderen Tönen erkannt werden könnte, so würde das bei der eben beschriebenen Methode gar nicht ins Gewicht fallen. Denn die Klangfarbe hängt zum größten Teil ab von den Obertönen, deren Schwingungszahl in geometrischem Verhältnis steht zur Höhe des Grundtones, mithin dieselbe bleibt, ob der Grundton etwas vertieft oder erhöht wird. Wir würden also den hellen Charakter des phonographisch aufgenommenen a1 wiederfinden, ob wir bei der Wiedergabe ein g, a, f u. s. w. zu Gehör bekämen. Damit wäre dann die Schwierigkeit beseitigt, welche die physikalischen Tonunterschiede desselben Instrumentes beziehungsweise Orchesters für die Gewinnung eines reinen Tonarten-Urteils bilden. Auf alle Instrumente läßt sich dies Experiment übrigens nicht ausdehnen, nämlich nicht auf solche, bei denen außer den Obertönen noch andere Töne oder Geräusche die Klangfarbe verursachen. Wir wissen z. B., daß durch den menschlichen Kehlkopf hervorgebrachte Vokale a e i o u durch Beitöne entstehen, die teils in relativer Beziehung zum Grundton stehen (Obertöne), teils aber eine feste absolute Sehwingungszahl haben, die nicht von der Grundtonhöhe abhängt. Diese festen Beitöne werden durch schnellere Rotations-Geschwindigkeit des Phonographen verändert und so auch der Vokalcharakter derart, daß man an einem etwa auf f gesungenen Vokal a, wenn man ihn so transponierte, nicht mehr den Vokal a erkennen könnte.
Herr Dr. Hennig war so liebenswürdig, meiner Bitte, Versuche mit seinem Tonarten-Gedächtnis anstellen zu lassen, nachzukommen. Allerdings ist Herr Dr. H. jetzt, wie er selbst angiebt, ganz außer Übung. Ich versuchte auf seine Bitte hin zuerst, wie er sich den Tönen seines eigenen Klaviers gegenüber verhält. Da er nur Moll-Tonarten zu erkennen angiebt, spielte ich lauter Molldreiklänge, manchmal zur genaueren Fixierung der Tonart Septimenakkord und Dreiklang der jeweiligen Tonart. Später experimentierten wir an einem Harmonium, dann an einem Herrn Dr. H. ungewohnten Klavier, dagegen haben wir noch keine Phonographen-Versuche angestellt.
Die Urteile waren folgende:
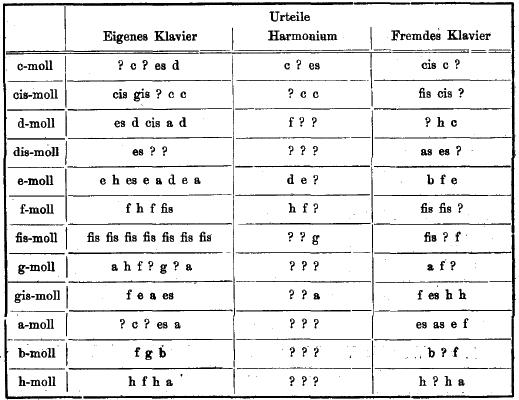
Es zeigt sich hieraus, daß eigentlich nur das Fis-moll von Herrn Dr. H. und zwar nur auf seinem eigenen Klavier gespielt, sicher erkannt wird; sonst sind die über die anderen Tonarten abgegebenen Urteile nicht statistisch verwertbar, weil sie von Zufallsurteilen nicht zu unterscheiden sind. Möglich, daß eine größere Statistik und größere Übung des Herrn Dr. H. andere Resultate zeitigen kann; vorläufig möchte ich aber glauben, daß Herr Dr. H. über ein gutes Klangfarben-Bewußtsein verfügt, welches ihn besonders den weichen fis-moll-Charakter seines Klaviers erkennen läßt, weniger um ein Tonarten-Bewußtsein an sich. Deshalb gab auch Herr Dr. H. verschiedentlich für das f-moll meines Klaviers, welches besonders weich klingt, das Urteil fis-moll ab.
Jedenfalls ist das absolute Tonarten-Bewußtsein, wenn es überhaupt ohne absolutes Tonbewußtsein besteht, in seiner Funktion äußerst unsicher. Die übrigen Möglichkeiten, in der Tonart mehr Anhalt zu finden als im einzelnen Ton, sind also entweder dadurch erklärt, daß der betreffende Beobachter ein partielles absolutes Tonbewußtsein besitzt, d. h. nur einzelne Töne beurteilen kann und so in der Tonart mehr Stützpunkte findet als im einzelnen Ton, oder durch Zuhilfenahme mittelbarer Kriterien, welche wie die Farben-Empfindung (Vorstellung) als Mitempfindung (Vorstellung) unabhängig vom Willen eintritt. So mag es vereinzelt, wie gesagt, vorkommen, daß die Tonart fis-moll erst Mondnacht und dann erst die Bezeichnung fis-moll produziert.
Es ist ja immerhin möglich, daß auch durch die Tonart ein bestimmter Gefühlseindruck erweckt wird, der, weil er für die Tonart charakteristisch ist, zu der Erkennung und richtigen Benennung hinführt. Worauf schließlich der Charakter der Tonart auch beruhen mag, ob auf instrumentell-tech-nischen oder konventionellen Gründen, es ist doch nicht zu leugnen, daß wohl jedem Musiker c-dur einen anderen Gefühlseindruck, als as-dur hinterläßt. Man kann zwar diese Gefühle nicht alle in Worte kleiden, jedenfalls nicht nur als angenehm oder unangenehm bezeichnen; sie sind inhaltlich verschieden. Diese Gefühle können also theoretisch wohl der mittelbare Weg sein, auf welchem Tonarten-Urteile gewonnen werden können. Individuen, welche diesen Sinn für Tonarten-Charakteristik haben, ohne absolutes Tonbewußtsein zu besitzen, müssen sich dieses aber leicht erringen können; denn wenn sie das Charakteristikum der Tonart auf die Tonika derselben übertragen, und das verlangt schon der Name Tonart, dann entsteht leicht aus dem absoluten Tonarten-Bewußtsein ein absolutes Tonbewußtsein. Es ist möglich, daß die Entwicklung des absoluten Tonbewußtseins sich so gestaltet, daß der Ton erst zum Individuum wird als Tonika einer charakteristischen Tonart. Doch so lange nicht Musiker gefunden werden, die in dem Entwickelungs-Stadium sind, in dem sie Tonarten aber keine Einzeltöne richtig beurteilen, ist kein faktischer Beweis für diese Hypothese zu erbringen. Die Regel scheint es jedenfalls nicht zu sein, daß sich ein absolutes Tonbewußtsein aus einem Tonarten-Bewußtsein entwickelt.
Ich habe bisher immer nur die eine Art des absoluten Tonbewußtseins behandelt, die darin besteht, daß ein gehörter Ton richtig bezeichnet wird, d. h. durch das Tonbild eine Reproduktion des Wortbildes stattfindet. Es wurde aber schon in der Einleitung erwähnt, daß auch der scheinbar umgekehrte physiologische Gang vorkommen kann, derart, daß durch das Wortbild ein Tonbild reproduziert wird. Diese Art des absoluten Tonbewußtseins ist deshalb von der ersten gesondert zu betrachten, weil sie mit dieser nicht gleichzeitig verbunden zu sein braucht. Es giebt eine Kategorie von Menschen, welche einen gehörten Ton richtig zu benennen im stande ist, sagen wir der Kürze halber, die Fähigkeit A besitzt; sie vermag aber nicht, aus dem Wortbild einen Ton zu reproduzieren (Fähigkeit B); wieder andere können Beides A und B. Schließlich giebt es eine Anzahl von Musikern, welche die Fähigkeit B haben, ohne Fähigkeit A zu besitzen. Von diesen letzteren möchte ich jetzt sprechen.
Es erscheint zuerst kaum verständlich, daß ein Mensch ein genaues Tonvorstellungs-Vermögen besitzt, ohne im stande zu sein, gehörte Klänge richtig zu beurteilen. Das anscheinend Paradoxe wird aber sogleich eliminiert durch die Thatsache, daß diejenigen, die sich Töne vorstellen können, aber gehörte nicht benennen können, sich mittelbarer Kriterien bedienen. Bei meiner Enquete habe ich dies als Regel ohne jede Ausnahme gefunden. Ob es eine theoretische Notwendigkeit ist, daß zu der Tonvorstellung solche Hilfs-Konstruktionen verwendet werden, kann ich allerdings nicht sagen. Bei der richtigen Höhen-Beurteilung gehörter Töne geht der Associationsweg vom Tonbild zum Wortbild, wovon übrigens noch des Genaueren gesprochen werden wird; wenn wir einen gewünschten Ton uns vorstellen und reproduzieren, dann geht die Association umgekehrt von Wortbild zu Tonbild. Der erste Weg ist ohne den zweiten möglich, wofür zahlreiche Beispiele existieren; dagegen finden sich keine Individuen, bei denen der zweite einfache Associationsgang stattfindet, ohne daß der erstere gelingt. Darum aber die Möglichkeit zu leugnen, wäre etwas kühn, obwohl die Verhältnisse leicht so liegen können, daß der Associationsweg II der schwierigere ist, und daß, wenn er einmal durch Übung erlangt ist, ohne weiteres auch Association I da ist. Dagegen schließt die Erlernung des leichteren nicht die Erlernung des schwierigeren mit ein.
Die mittelbaren Kriterien, welche zur Tonvorstellung zu Hilfe genommen werden, sind dieselben, wie wir sie bei der Tonhöhen-Beurteilung kennen gelernt haben, nur kommen hier hauptsächlich die Hilfsmittel in Betracht, welche mit bewußtem Willen herangezogen werden, und zwar werden optische und Bewegungs-Vorstellungen zu Hilfe genommen. Ein Geiger stellt sich oft die Lage seiner Hand an der Geige und seine Fingerstellung beim Niederdrücken einer Saite vor, um sich ein Tonbild zu vergegenwärtigen. Bei meiner Enquete fand ich zwei Musiker, welche, um sich den Kammerton a zu vergegenwärtigen, in der Vorstellung die Geige in die Hand nahmen, um auf der d-Saite mit dem zweiten Finger in dritter Lage ein a zu produzieren; es war ihnen dies eine große Erleichterung für die Vorstellung des a. Dieses Kriterium kann in das Gebiet des Gesichtssinnes und der Bewegungs-Vorstellung fallen.
Wieder andere Musiker neigen mehr dazu, sich optische Erinnerungsbilder zu Hilfe zu rufen. Der eine stellt sich zur Reproduktion eines Tones dessen Notenbild, ein zweiter sein Klaviertasten-Bild vor. Ein dritter stellt sich selbst am Klavier sitzend vor und einen bestimmten Ton anschlagend. Speziell von Sängern werden noch ganz andere associative Komplexe verwendet, um einen bestimmten Ton, meist handelt es sich um den Kammerton a, in der Vorstellung zu fixieren. Manche stellen sich den gewünschten Ton als Anfangs ton eines Liedes vor, das sie auswendig kennen, und wenn sie ganz in dem Wahne sind, das Lied zu singen und auch die Gefühlswirkung des Liedes mit in Betracht ziehen, gelingt es ihnen oft, den Ton richtig anzugeben. Wieder andere stellen sich ganze scenische Bilder vor. So gab ein Musiker an, daß er die a-Vorstellung auf folgende Weise erhalte: er denkt an die Schlußszene des, zweiten Aktes des »Don Juan«, an den Gesang des Komtur, der mit den Noten beginnt a0, d1, d0, -d0, f0, d0, a0, a0. Dies stellt er sich mit allen dazu gehörigen scenischen Bildern vor und ist so im stande, mit fast absoluter Sicherheit den richtigen Ton a zu treffen, was ihm ohne diese mittelbaren Kriterien ganz unmöglich ist.
Von den hundert Beantwortern meines Fragebogens mußten sich drei das Tastenbild, sieben das Notenbild und zwei das ganze scenische Bild vorstellen, um den Ton zu reproduzieren.
Früher war die Anschauung sehr verbreitet, daß es unmöglich sei, einen Ton im Geiste zu beurteilen oder zu reproduzieren, ohne ihn zu singen oder die zum Singen notwendigen Muskel-Bewegungen im Kehlkopf zu machen, oder wenigstens den Ton sich als gesungen vorzustellen, d. h. die für die Muskel-Bewegungen nötigen Nerven-Erregungen im Gehirn vorzubereiten. Wir könnten uns also theoretisch vorstellen, daß rein aus dem Muskel-Gefühl (Kontraktions-Gefühl), welches wir bei der Tonerzeugung haben, ein Ton erkannt wird, wenn der Beobachter aus früheren Versuchen weiß, daß diese Muskel-Anspannung einem bestimmten Ton entspricht; danach ist es möglich, daß ein Mensch rein durch ein »absolutes Kehlkopfmuskel-Bewußtsein« im stande ist, gewünschte Tonhöhen zu singen, ohne eine Spur von absolutem Tonbewußtsein zu besitzen. Das Kriterium des Muskelsinns kann aber weiter auch ein mangelhaftes absolutes Tonbewußtsein stützen und ergänzen.
Lotze[21] bemerkt: »Keine Erinnerung von Tönen und Tonreihen geht vor sich, ohne von stillem intendiertem Sprechen oder Singen begleitet zu werden. Dadurch wird jedes Tonbild mit einem schwachen Erinnerungsbild nicht allein, sondern mit einer leisen wirklichen Erregung jenes Muskel-Gefühls associiert, das wir bei der Hervorbringung des Tones empfinden würden.«
G. E. Mueller[22] stimmt Lotze bei: »In der That, man versuche nur einmal, einen gehörten Klang oder eine Reihe bestimmter Klänge ohne gleichzeitige Intentionen zu entsprechenden Bewegungen des Stimmorgans sich zu vergegenwärtigen. Es wird dies, wenigstens unseren Beobachtungen nach, entweder nie gelingen oder nur zuweilen unmittelbar nach der sinnlichen Wahrnehmung des betreffenden Tones, wo es sich also um ein Erinnerungs-Nachbild handelt«.
Gegen diese Ansicht macht Stumpf in seiner Tonpsychologie[23] Front. Nach seinen und anderer Erfahrungen ist ein innerliches Singen nicht notwendig für eine Tonvorstellung; er führt auch gegen die obigen Ansichten verschiedene Argumente ins Feld:
1) müßte sonst die Feinheit, mit der wir Töne unterscheiden, sich mit der Feinheit der Unterscheidung dieser Muskel-Empfindungen decken; man müßte also im stände sein, innerhalb der Tonstufe h1-c2 90 verschiedene Töne hervorzubringen, denn etwa so viele lassen sich von geübten Ohren unterscheiden;
2) könnte man eine Reihe von Tönen nicht schneller im Gedächtnis durch laufen, als man sie zu singen im stande wäre;
3) könnte man sich keine Tonmehrheit vorstellen;
4) ist kein Grund vorhanden, daß Töne, die wir hören können, ohne mitzusingen, nicht auch Erinnerungsbilder haben, die auftauchen können, ohne sich mit einer anderen Vorstellung und Empfindung zu verbinden.
Das erste Argument Stumpf's beweist, daß Urteile über Unterschieds-Empfindlichkeit nichts mit Muskel-Empfindungen zu thun haben. Gegen das dritte Argument Stumpf's könnte ein Anhänger der Muskel-Empfindungs-Theorie sagen, daß man sich vielleicht gar keine Mehrheit von Tönen vorstellt, sondern daß man sich mehr die Gefühlswirkung vergegenwärtigt, die ein Akkord hervorbringt. Doch glaube ich, daß man im stande ist, sich willkürlich entweder eine Tonmehrheit oder die Gefühlswirkung derselben vorzustellen, je nachdem man seine Aufmerksamkeit mehr den absoluten Tonhöhen oder der Intervallwirkung (Verschmelzung, Harmonie) zuwendet.
Den Stumpf'schen Argumenten möchte ich noch weitere hinzufügen:
1) Zunächst bin ich im stande, mir Töne vorzustellen, die weit außer dem Bereich meines Stimmumfanges, ja meiner ganzen musikalischen Reproduktions-Pähigkeit liegen; ich bin ebenso im stande, mir ein C5 wie ein Kontra-C vorzustellen, obwohl ich mit dem Gesang nur bis zum F und mit Pfeifen bis g4 komme. Außerdem müßte ich bei der Vorstellung hoher Töne Muskel-Empfindungen in den Lippen haben und Kontraktionen, die noch deutlicher zu beobachten wären, als die Kehlkopfmuskel-Anspannungen.
2) Kann ich einen beliebigen Ton singen und mir gleichzeitig einen anderen Ton vorstellen. Dies ist meiner Ansicht nach der schlagendste Beweis, daß zur Tonvorstellung keine Muskel-Empfindung nötig ist. Und doch hat Stricker[24] einen ähnlichen Einwand Paulhan's zurückgewiesen. Paulhan stellte seinen Versuch so an, daß er den Buchstaben A laut spricht, und während dieser lauten Aussprache des A denkt er sich der Reihe nach E, I, O, U und selbst einen ganzen Vers. Stricker bemerkt dem gegen über: »Wenn man das A laut spricht, muß man im Beginne der Aussprache allerdings den Muskel, der die Mundhöhle und Mundspalte in eine gewisse Stellung bringt, beschäftigen, ist aber einmal die Stellung vorhanden, dann wird das A nur mit Hilfe der tönenden Exspirationsluft verlängert, die Ar tikulationsmuskeln des A können jetzt neuerdings innerviert werden, um für die Vorstellung des 0 und E in Wirksamkeit zu treten. Eine solche Art des Experimentes, schließt Stricker, entspricht aber nicht meiner Forderung, denn ich muß noch einmal hervorheben, meine Anforderung geht dahin, sich das A und O bei eingehaltener Athmung wirklich gleichzeitig vorzustellen. Sollte jemand dies vermögen, dann kann er damit als mit einem Argumente gegen mich auftreten.« Ich glaube nicht, daß Stricker dieses Argument gelten ließe, er würde entweder nicht an die Sicherheit der subjektiven Beobachtung glauben oder annehmen, daß alternierend das A und 0 vor gestellt werde. Gegen unsere Anwendung auf die Musik, daß es leicht ist, sich eine Tonmehrheit vorzustellen, könnte er auch noch jenen oben erwähnten Einwand geltend machen, daß wir uns wohl gar nicht die Tonmehrheit, sondern nur den Gefühlseindruck der Akkorde vergegenwärtigen.
Hierbei möchte ich eine Beobachtung mitteilen, die ein Licht darauf wirft, daß zwar nicht Muskel-Empfindungen, wohl aber Gesangs-Vorstellungen häufig bei Ton-Vorstellungen vorkommen, und daß es oft Schwierigkeit macht, sich von diesen zu befreien.
Ich sang mit kräftiger Stimme ein g, hielt diesen Ton möglichst lange aus und stellte mir während dessen irgend eine mir geläufige Melodie vor; sobald die Töne des Liedes große Intervalle bildeten mit dem gesungenen Ton ff, empfand ich weiter keine Schwierigkeiten; wenn aber die Töne des gedachten Liedes bis auf einen Ganzton oder gar einen Halbton an das gesungene ff heranrückten, dann wurde die Sache bedeutend schwieriger. Mußte ich mir z. B. ein as vorstellen, dann wurde unwillkürlich der ausgehaltene Gesangston ff in die Höhe gezogen, nicht um einen Halbton, vielleicht um einen Vierteiton. Suchte ich dem abzuhelfen, indem ich den gesungenen Ton g recht stark hervorbrachte, dann wurde umgekehrt das vorgestellte as etwas hinuntergezogen. Es fand also eine fortwährende Beeinflussung des gesungenen und des vorgestellten Tones statt, sobald beide dicht neben einander lagen. Dieses erkläre ich mir so, daß ich von dem vorgestellten Tone eine Gesangs-Vorstellung habe. Ebenso ruft der gesungene Ton eine Gesangs-Vorstellung hervor. Liegen alsdann beide Gesangs-Vorstellungen dicht neben einander, so stören sie sich, sind sie sehr verschieden von einander, so findet keine Beeinflussung statt. Es ist mir hierbei auch aufgefallen, daß, während ich sonst mir Töne jeder beliebigen Klangfarbe als Geigen, Klarinetten, Blasinstrumente denken kann, ich dies in dem obigen Versuche nicht erreichen konnte. Der Ton, der nur einen Halbton von dem gesungenen Ton entfernt gedacht wurde, hatte immer die Gesangsklangfarbe und zwar die meines eigenen Stimm-Timbres. -- Denselben Versuch ließ ich mehrere, stimmlich sehr begabte Musiker anstellen und konnte jedesmal die Schwankungen des gesungenen Tones feststellen, sobald sich der vorgestellte Ton ihm näherte. Hiernach scheinen also Gesangs-Vorstellungen viel wichtiger zu sein für absolute Ton-Vorstellungen als Muskel-Empfindungen; ob übrigens die Gesangs-Vorstellungen notwendig sind, und ob es nicht auch in unserem Versuche gelingen kann, sich von ihnen zu emanzipieren, steht noch dahin. Unsere Gesangs-Vorstellung ist aber weit entfernt von einem Innervations-Gefühl im Sinne einer Empfindung, wie es sich verschiedene Forscher zurecht konstruiert haben; es handelt sich vielmehr um ein einfaches Gedächtnisbild eines Gesangstones ohne jede muskuläre Beimischung.
Was nun das absolute Kehlkopfmuskel-Bewußtsein, von dem ich oben sprach, anbetrifft, so ist dessen Existenz bisher unbewiesen, aber auch schwer zu eruieren. Wohl kann man sich vorstellen, daß ein Sänger nach langdauernder Übung im stande ist, die Muskeln seines Kehlkopfes so genau einzustellen, daß ein bestimmter beabsichtigter Ton entsteht, auch ohne daß er ein absolutes Tonbewußtsein besitzt. Faktisch aber habe ich keinen einzigen Sänger kennen gelernt, der dazu fähig wäre, weder1 bei meiner verschiedentlich citierten Enquete, noch bei vielfachen anderen diesbezüglich angestellten Versuchen. Ich glaubte früher, selbst diese Fähigkeit zu besitzen, weil ich scheinbar sofort auf Kommando einen beliebigen Ton (etwa c) singen konnte; aber bei genügender Beobachtung merkte ich, daß erst immer das Tonbild c im Ohre auftauchte, und dann erst der Kehlkopf richtig eingestellt wurde. Es findet also immerwährend eine Kontrolle der Muskel-Empfindung durch den Gehörsinn statt (im Gegensatz zu der oben besprochenen Ansicht, daß der Gehörsinn durch den Muskelsinn kontrolliert würde). Ich wollte nun versuchen, ob man es nicht vermeiden könnte, daß das Tonbild auftauche, und ob man nicht aus einer bestimmten Kontraktion der Kehlkopfmuskeln die derselben entsprechende Tonhöhe angeben könne. Eine auf normalem Wege erzeugte Kontraktion ist hierfür nicht zu verwenden, weil eben sofort, sobald irgend ein Buchstabenbild auftaucht, das entsprechende Tonbild und dann die diesem korrespondierende Muskel-Kontraktion da ist. Ich dachte daher folgenden Versuch anzustellen: Ich wollte meinen Kehlkopfmuskel [musculus cricothyreoideus), den Spanner der Stimmbänder, galvanisch oder faradisch reizen lassen und nun aus dem jeweiligen Spannungsgefühl des Kehlkopfes den Ton ermitteln, der bei einfacher Luftexspiration entstehen mußte. Leider aber sagten mir mehrere Kehlkopfärzte, die ich darum anging, daß man nicht im stande wäre, den Muskel isoliert zu reizen, obwohl er einen eigenen, nur ihn versorgenden Nerven, den nervus laryngeus superior, besitzt.
Wir sehen also einerseits, daß das mittelbare Kriterium des Singens zur Ton-Feststellung und Ton-Vorstellung unnötig ist und andererseits, daß ein absolutes Kehlkopfmuskel-Bewußtsein ohne absolutes Tonbewußtsein bisher nicht beobachtet ist.
Damit ist aber noch nicht gesagt, daß der Gesang nicht doch als Hilfsmittel für Ton-Vorstellungen angewandt wird. Im Gegenteil, wir sehen häufig, daß Musiker, über Tonhöhen befragt, erst gesanglich herumprobieren und dann erst ihr Urteil abgeben. Meist handelt es sich dann um Töne mit ungewohnter Klangfarbe, bei Glocken- und Gläsertönen wird das Nachsingen häufig angewandt. Der Zweck dabei ist nach dem, was in dem die Klangfarbe behandelnden Paragraphen gesagt wurde, leicht einzusehen: Wir führten aus, daß man bei Tonhöhen-Bestimmungen erst aus der Klangmasse eine Einheit analysieren muß, die man durch Übung und Gewohnheit mit der Namens-Bezeichnung des Tones versieht. Wir sprachen von einer Klavierton-Einheit u. s. w. Wenn nun ein Musiker im Bestimmen von Gesangstönen eine große Fertigkeit hat, also eine Gesangston-Einheit besitzt, dann bezieht er leicht andere Klänge auf diese, und da die Empfindung immer stärker ist, als die Vorstellung, so vergleicht er direkt mit dem Gesangs-Timbre, indem er den Ton nachzusingen versucht.
In ähnlicher Weise hilft man sieh bei ganz tiefen und hohen Tönen, die man direkt nicht zu bestimmen vermag, damit, daß man versucht, Oktaven des zu bestimmenden Tones zu singen, da meistens der Intervallsinn in großer Tiefe und Höhe besser funktioniert als das absolute Tongedächtnis. Es hilft sich dann also fortwährend Intervall-Vergleichung und absolutes Tonbewußtsein.
Schließlich wird das Nachsingen des Tones noch in einer anderen Weise zur Tonhöhen-Bestimmung verwendet. Viele Musiker, die entweder gar nicht oder nur in unsicherer Weise im stande sind, Tonhöhen zu bestimmen oder sich vorzustellen, singen, ihren tiefsten beziehungsweise höchsten Gesangston, den sie hervorzubringen vermögen und dessen Höhe sie kennen, vergleichen dann den zu bestimmenden Ton mit diesem Gesangston durch Intervall-Abschätzung und ermitteln so die Höhe des Klanges. Dies ist allerdings auch ein Tonhöhen-Urteil, welches aber streng genommen mit unserem absoluten Tonbewußtsein nichts zu thun hat; es ist nur ein logischer Schluß, erhalten durch Intervall-Urteil und die Kenntnis des Stimmumfangs. Außerdem ist es sehr unsicher, sich auf ein solches Tonurteil zu verlassen, meist fällt dies fehlerhaft aus. Denn der tiefste (auch der höchste) Singeton, den wir hervorbringen können, unterliegt ganz bedeutenden Schwankungen; morgens ist er ein anderer wie abends und hängt außerdem noch von den verschiedensten Witterungs- und diätetischen Verhältnissen ab. Feuchte Luft vertieft den Ton, ebenso Rauchen und Biergenuß. Jedenfalls glaube ich nicht, daß allein aus der Muskel-Empfindung des Kehlkopfs beim Nachsingen des Tones die Höhe desselben erschlossen werden kann, aber ein unsicheres Urteil kann mit Hilfe dieser Empfindung gekräftigt werden.
Es scheint somit, daß die mittelbaren Kriterien für die Tonvorstellung noch brauchbarer sind, als für die Tonhöhen-Beurteilung, und da hierbei fast nur die vom Willen abhängigen Vorstellungen oder Empfindungen verwendet werden, so sind sie nicht so dem Zufall unterworfen wie die automatischen Mitempfindungen und Reflexe. Wenn diese Kriterien nun oft benutzt werden, dann tritt durch diese Übung auch eine feinere Differenzierung der Empfindung und Vorstellung (besonders beim Gresange) ein, und es prägt sich die absolute Höhe des vorgestellten Tones immer mehr dem Gedächtnis ein, so daß aus diesem mittelbaren Wege, zur Tonvorstellung zu kommen, nach längerer Übungszeit ein unmittelbarer Weg werden kann.
Wir sahen, daß es eigentlich drei Arten von absolutem Tonbewußtsein giebt:
1) das Tonbild reproduziert das Wortbild, nicht umgekehrt;
2) das Wortbild reproduziert das Tonbild, nicht umgekehrt;
3) sowohl Tonbild wie Wortbild reproduzieren sich gegenseitig.
Nachdem wir also die zweite Art jetzt besprochen haben und gesehen haben, daß die mittelbaren Kriterien eine unerläßliche Bedingung für diese Tonerkenntnis sind (wenigstens nach meinen Erfahrungen), wäre noch übrig, die dritte Gruppe zu besprechen. ,
Von allen, die sich rühmen, ein absolutes Tonbewußtsein zu besitzen, sind nach meiner Statistik 35% im stande, einen gehörten Ton richtig zu benennen und ebenfalls einen gewünschten Ton sich richtig vorzustellen und zu produzieren. Bei allen diesen ist das absolute Tonbewußtsein besonders stark ausgeprägt, schnell funktionierend und für sehr feine Tonunterschiede brauchbar.
Es ist dies auch leicht erklärlich: ein Musiker, der nur gehörte Töne richtig benennen kann (Fähigkeit A), muß bei einer Vierteltonstufe die Grenze seiner Urteils-Fähigkeit erlangt haben. Den Ton a kann er als a beurteilen, da das Tonbild a das Wortbild a auslöst, den Ton b beurteilt er als b. Einen Ton aber, der nur wenig von a differiert, beurteilt er ebenfalls als a, und wenn er etwa in der Mitte zwischen a und b liegt, als a oder b, weil beide Wortbilder, a und b, bei ihm reproduziert werden und er daraus schließt, daß der Ton zwischen a und 6 liegen muß. Das Intervall von einer Vierteltonstufe ist noch ziemlich groß, und geringere Unterschiede sind auf diesem Associationswege nicht zu erkennen.
Ganz anders bei einem Musiker, welcher neben der Erkennung der Tonhöhe auch die Fähigkeit einer wirklichen Ton-Vorstellung besitzt. Er kann jeden gehörten Ton mit dem Ton seiner Vorstellung, welcher derselben Ton-Bezeichnung entspricht, vergleichen und so feinste Unterschiede bemerken. Diese Fälle sind, wie gesagt, nicht allzuselten zu finden. Früher aber galt solch Gehör für fabelhaft und veranlaßte die Kritiker zu den wunderbarsten Erklärungen. Besonders berühmt ist die Anekdote geworden, welche der Hofkomponist Schachtner von dem 7jährigen Mozart berichtet. Dieselbe ist zwar schon an verschiedenen Orten wiedergegeben, ich halte es aber doch für wert, sie noch einmal, wie sie in der Jahn'schen[25] Mozart-Biographie angegeben ist, zu wiederholen:
Schachtner erzählt: »Sie wissen sich zu erinnern, daß ich eine sehr gute Geige habe, die weiland Wolfgangerl wegen ihrem sanften und vollen Ton immer Buttergeige nannte. Einmal .... geigte er darauf und konnte meine Geige nicht genug loben; nach ein oder zwei Tagen kam ich wieder, ihn zu besuchen, und traf ihn, als er sich eben mit seiner eigenen Geige unterhielt, an; sogleich sprach er: »Was macht ihre Buttergeige?« Geigte dann wieder in seiner Phantasie fort, endlich dachte er ein bischen nach und sagte zu mir: »Herr Schachtner, Ihre Geige ist um einen halben Viertelton tiefer gestimmt als meine da; wenn Sie sie doch so gestimmt ließen, wie sie war, als ich das letzte Mal darauf spielte.« Ich lachte darüber, aber Papa, der das außerordentliche Tönegefühl und Gedächtnis dieses Kindes kannte, bat mich, meine Geige zu holen und zu sehen, ob er recht hätte. Ich that's und richtig war's.«
Diese kleine Scene ist sehr interessant, läßt sich aber leider für die Kritik des Mozart'schen Gehörs wenig verwerten; erstens ist das Vergleichs-Instrument seines absoluten Tonbewußtseins eine Geige, welche wegen ihrer leichten Verstimmbarkeit keine korrekten Resultate zuläßt. Temperatur, Feuchtigkeit und Spannung lassen einigermaßen neue Saiten in wenigen Tagen meistens recht erheblich in der Stimmung heruntergehen. Zweitens ist die Bestimmung »ein halber Viertelton« scheinbar recht bestimmt, doch hat die Erfahrung gezeigt, daß man mit der Bezeichnung 1/8 Ton u. s. w. sehr ungenau umgeht, und daß die Schätzung der Intervalle, die kleiner sind als 1/4 Ton, sehr unsicher und fehlerhaft ist. Selbst wenn aber die Geige dauernd ihre Stimmung genau gehalten hätte, und wenn die Tondifferenz beider Geigen genau 1/8 Ton betragen hätte, so ist doch diese Leistung Mozart's noch nicht so wunderbar, wie vielfach geglaubt wird. Aus den nachfolgenden Tabellen über Prof. Raif's und mein absolutes Tonbewußtsein wird hervorgehen, daß diese Feinheit des absoluten Tonbewußtseins keine exceptionelle ist. Allerdings war Mozart damals ein 7 jähriges Kind, doch finden wir häufig ein sehr scharfes absolutes Tonbewußtsein schon in ganz jungen Jahren (5.--7. Lebensjahr); bei den 100 Fällen meiner Enquete haben mir 24 angegeben, das absolute Tonbewußtsein schon vor dem 8. Lebensjahr gehabt zu haben.
Daß aber diese Fähigkeit Mozart's gerade so besonders hervorgehoben und als wunderbar bezeichnet wird, hat zur Folge, daß Hennig in seinem mehrfach citierten Buche »Zur Charakteristik der Tonarten« daran die Bemerkung knüpfte, daß solche Feinheit des absoluten Tonbewußtseins völlig undenkbar sei, wenn man nicht annähme, daß Mozart zur Bestimmung der Tonhöhe Associationen des Gehör- und Gesichtssinnes zu Hilfe genommen hätte, d. h. bei jedem Ton (Achtelton und weniger) Farben-Empfindungen gehabt habe. Da einerseits keine Litteratur-Bemerkung existiert, daß Mozart beim Hören von Tonen Farben-Empfindungen gehabt habe, andererseits ein absolutes Farben-Bewußtsein von derselben Feinheit, wie sie nach der Hennigschen Erklärung nötig war, wohl ebenso selten gefunden wird, wie ein absolutes Tonbewußtsein, so sehe ich diese Ansicht durch keinerlei Grund gestützt.
Wir beide, Prof. Raif und ich, haben Versuchsreihen über die Feinheit unseres absoluten Tonbewußtseins angestellt, aber keine Spur von irgendwelchen Gesichts-Associationen zu Hilfe genommen. Die meisten Musiker, die meinen Fragebogen beantwortet haben, besitzen ebenfalls keine audition coloree; die wenigen aber, die Farben-Vorstellungen beim Hören von Tönen haben, leiten ihr Tonurteil nicht etwa aus der Farben-Vorstellung ab. Das Tonurteil ist sofort da, daneben die Farben-Vorstellung, koordiniert, nicht das Tonurteil subordinierend.
Ich stellte die Versuche über die Genauigkeit absoluter Tonhöhen-Bestimmungen in doppelter Weise an. Mit Hilfe eines Appunn'schen »Tonmessers«[26] sind wir im stande, eine kontinuierliche Reihe von Tönen, die nur um wenige Schwingungen differieren, hervorzubringen. Wir wandten nun zwei Methoden an, die der Auswahl und die Methode der richtigen und falschen Fälle.
Bei der Auswahl-Methode wurde ich zunächst von Dr. M. Meyer in liebenswürdiger Weise unterstützt. Dieser gab einen beliebigen Ton in der Nähe des Kammertones a an; ich sagte, ob dies ein richtiges a wäre oder nicht; wenn ich es ablehnte, dann ging er höher oder tiefer in der Tonreihe weiter, bis ich erklärte, daß der gehörte Ton ein richtiges a nach meinem Tonbewußtsein wäre. Hierbei zeigte sich evident, daß ich, um genauere Tonurteile zu gewinnen, vollkommen bewußt vergleiche mit einem in meiner Erinnerung befindlichen Ton. Diese Versuche sind in der Kries'schen[27] Weise nicht zu erklären; ein Ausprobieren von Schwingung zu Schwingung, welches das richtige a sei, ist ohne Vergleichung mit einem bestimmten Ton des Bewußtseins unmöglich. Nicht nur daß ich weiß, daß ich bewußt vergleiche, habe ich bei diesen Versuchen, da die Ton-Vorstellung zu schwach war im Vergleich zu den lauten Tönen des Tonmessers, das a meines Bewußtseins oft durch Singen angegeben und konnte so leicht vergleichen. Die mittels der Auswahl-Methode gewonnenen Resultate waren tabellarisch zusammengestellt folgende:
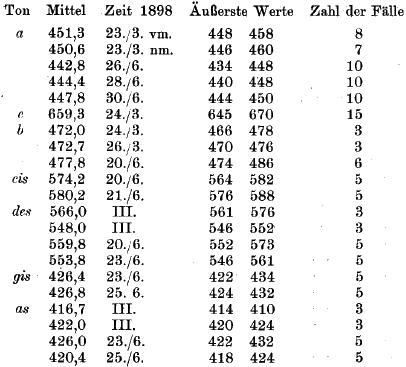
Die Besprechung dieser Tabelle möchte ich erst vornehmen, nachdem ich die Tabellen der zweiten Methode angeführt habe, der Methode der richtigen und falschen Fälle: Es wurde ein a im Umfange der Töne 435--460 intoniert, und der Beobachter notierte das Urteil »gut (g)«, »zu hoch (h)c oder »zu tief (t)«. Mit Meyer habe ich für jeden der angegebenen Töne 24 Versuche angestellt. Sie folgen in nachstehenden Tabellen.
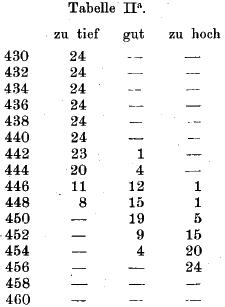
Da mir die Versuchsreihen zu klein schienen, stellte ich im Frühjahr 1899 neue Reihen an, wobei Prof. Raif und ich als Versuchs-Personen fungierten.
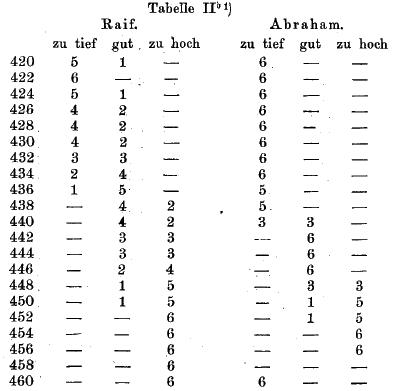
[Die links stehenden Schwingungszahlen sind die Ziffern, welche an unserem Appunn'schen Tonmesser notiert sind. Da die Stimmung der Metallzungen des Apparates nicht ganz stetig und genau ist, wurde sie im Herbst 1900 von den Herren Dr. K. L. Schaefer und Cand. Pfungst nach ihrer wirklichen absoluten Tonhöhe aufs Genaueste bestimmt; dies geschah mit Hülfe einer geaichten Normalstimmgabel und Zählung der Schwebungen aller Zungen mit ihren Nachbarn. Hierbei ergab sich, daß der wahre Umfang dieses Tonmessers von 403--807, anstatt von 400--800 reichte. Ob meine vor drei Jahren angestellten Versuche nun mit dieser letzten genauen Stimmung übereinstimmen, ist zweifelhaft; doch kommt es hier ja auch weniger auf die ganz genaue absolute Schwingungszahl an, als auf den Umfang der einzelnen Tonbegriffe. Jedenfalls aber werde ich jetzt, bei der Besprechung der Tabellen, die neuen Zahlen den alten in Klammern beifügen.]
Wenn wir auf den Tabellen zunächst die Resultate betrachten, die wir bezüglich des a erhalten haben, so zeigt sich, daß das a meiner Vorstellung nach der Auswahl-Methode (Tabelle 1} schwankt zwischen 434 (437) und 460 (463) und abgesehen von den Ausnahmetällen, welche diese Grenzwerte waren, zwischen den Mitteln 442,8 (445) und 451,3 (454). Nach der Methode der richtigen und falschen Fälle (Tabelle II3) schwankt das a zwischen 442 (445) und 454 (457), nach Tabelle IIb zwischen 436 (439,5) und 452 (455). Die Resultate stimmen sehr gut mit einander überein. Auffallend ist die sehr hohe Stimmung meines Tonbewußtseins. Mein Vorstellungs -a schwankt also zwischen den Grenzwerten 434 (437) und 460 (463) und nach Ausschluß der Ausnahmefälle zwischen 443 (446) und 451 (454) nach Methode a, zwischen 440 (443) und 448 (451) nach Methode b. Während ich in dieser Weise hoch gestimmt bin, lag das Vorstellungs-a von Prof. Raif zwischen 420 (423) und 450 (453) und nach Ausschluß der Ausnahmefälle zwischen 432 (435) und 444 (447). Ich bezeichnete 442--446 in allen Fällen als gut.
Woher rührt nun diese Verschiedenheit des a-Begriffs bei beiden Beobachtern? Es liegt nahe, die Erklärung darin zu suchen, daß das Instrument, auf welchem man am meisten musiziert, dem Gedächtnis seine Stimmung am stärksten einprägt. Ich machte infolgedessen eine Prüfung der Stimmung meines Klaviers, sein a hat 438 Schwingungen; ich war darüber nicht weiter erstaunt, denn ich wußte schon lange, daß mein Vorstellungs-a höher ist, als das a meines Klaviers. Ich suchte nun lange nach einer anderen Ursache der hohen Stimmung meines absoluten Tonbewußtseins und glaube sie in Folgendem gefunden zu haben: Das Klavier, auf dem ich meine ersten Klavierstudien vom 5. bis 13. Lebensjahre machte, stand ungewöhnlich tief, über 1/4 Ton unter der Normalstimmung; ich wußte dies, weil ich häufig meine Geige zur Begleitung eines anderen Klaviers höher stimmen mußte. Deshalb gewöhnte ich mir bald ab, meine Geige nach meinem Klavier zu stimmen, und stimmte nach dem a meines Gedächtnisses, das durch andere Klavierstimmungen undeutlich fixiert war, und das ich immer mit meinem Klavier-a verglich, es aber absichtlich höher stimmte, als dieses. Es ist nun eine bekannte Thatsache, daß man in der Musik kleine Distanzen überschätzt, und so hatte ich wohl auch meine Geige und allmählich mein Vorstellungs-a zu hoch gestimmt. So ist wahrscheinlich aus der zu tiefen Stimmung meines Klaviers die hohe Stimmung meines absoluten Tonbewußtseins zu erklären, die höher ist als alle modernen Instrumentalstimmungen. Bei Herrn Prof. Raif war die Ursache seiner Stimmung leicht zu eruieren, sein Klavier stand im normalen Kammerton 435 und mit diesem stimmte sein Vorstellungs-a (437--443) gut überein. Prof. Raif berichtete mir außerdem, daß er in jedem Sommer, wenn er von seiner Reise zurückkehrte, in seinem Tonbewußtsein tiefer gestimmt war, weil er in dem Ort, in dem er sich alljährlich aufhielt, auf einem Klavier spielte, das um 1/2 Ton tiefer stand als unsere Normalstimmung.
Daß diese Ton-Vorstellungen keine ganz stetigen sind, sondern vielen Schwankungen unterliegen, zeigen unsere Tabellen ebenfalls in deutlichster Weise. Bei der Tabelle I ist jedesmal das Datum des Versuchstages notiert, und ein kurzer Blick auf diese Daten zeigt, wie verschieden meine Vorstellungs-Stimmung an den einzelnen Tagen war; weiter ist auch der Einfluß der Übung aus unseren Tabellen zu erkennen. Während im Sommer 1898 mein Vorstellungs-a noch zwischen 442 (445)--454 (457), im engen Kreise zwischen 446 (449) und 452 (455) schwankte, konnte ich nach häufigen akustischen Untersuchungen in der Normalstimmung (a = 440) konstatieren, daß meine Stimmung herunterging auf 438 (441) -- 452 (455), im engeren Kreise zwischen 442 (445) und 446 (449,5).
Was nun die Genauigkeit der Stimmung, d. h. den Umfang des a-Begriffs anbetrifft, so betrug dieselbe nach den letzten Reihen = 8 Schwingungen 440 (443)--448 (451); dabei sind selbst die Endwerte 440 (443) und 448 (451), bei denen das Urteil gut nur in 50% der Fälle gefällt wurde, mitgerechnet; ohne diese wurde in 10.0% der Fälle richtig geurteilt zwischen 442 (445) und 446 (449). Bis auf 4 Schwingungen bin ich also im stande, eine Tonvorstellung a gegen eine andere abzugrenzen. Wenn man nun a = 440 annimmt, so würde das nächst höhere h = 495 Schwingungen haben. Die Differenz 55 Schwingungen entspricht also einem Ganzton dieser Tonlage, mithin unsere 4 Schwingungen = 4/55 = 1/11.25 einer Ganztonstufe. Ich habe dies nur ausgerechnet, um zu zeigen, daß die pben citierte Anekdote aus Mozart's Leben kein exceptionelles absolutes Tonbewußtsein beweist, sondern daß diese Genauigkeit durch akustische Übungen leicht erreicht werden kann, wenn ein absolutes Tonbewußtsein überhaupt vorhanden ist. Prof. Raif, der in speziell akustischen Dingen weniger Übung hatte, als ich, war an den ersten Versuchstagen noch nicht im stande, in so geringem tonalen Umfange die Vorstellung zu präzisieren, bekam aber nach wenigen Versuchstagen eine solche Übung im Urteilen, daß sich die Grenzen seines Vorstellungs-a von 26 bis auf 8 Schwingungen zusammenzogen.
Es wäre nun sehr interessant, die Feinheit des absoluten Tonbewußtseins, d. h. das absolute Unterschieds-Gedächtnis zu vergleichen mit der Unterschieds-Empfindlichkeit für Tonhöhen; es würde diese Vergleichung einen Maßstab geben, in welchem Grade die Exaktheit eines Gedächtnisbildes von dem eines Wahrnehmungsbildes abweicht. Genauere Versuchsreihen über meine Unterschieds-Empfindlichkeit habe ich noch nicht angestellt, ich weiß aber aus früheren Versuchen, daß ich 2 Töne in der Gegend des a1, die um weniger als 0,5 Schwingungen variierten, noch als verschieden erkannt habe, und zwar richtig den höheren als zu hoch, den tieferen als zu tief. Wenn dies die Grenze meiner Unterschieds-Empfindlichkeit wäre, so würde das Gedächtnisbild, welches 4 Schwingungen umfaßt, 4/0.5 mal, d. i. 8 mal undeutlicher sein, als das Wahrnehmungsbild, kontrolliert durch zwei kurz auf einander folgende Empfindungen. Jedenfalls wäre es sehr lohnend, diesen Punkt noch weiter zu verfolgen und auch mit dem Gedächtnis für Tonhöhen überhaupt (nicht dem absoluten Tonbewußtsein) zu vergleichen.
Außer dem a untersuchte ich noch das e und b meines Tonbewußtseins mit ähnlichem Ergebnis, daß ein sehr konstantes Urteil für alle Fälle erzielt wurde.
Besonders interessant ist noch die verschiedene Vorstellung von eis und des einerseits und von gis und as andererseits. Die Töne sind auf dem Klavier bekanntlich identisch, theoretisch dagegen ist fis tiefer als ges: cis tiefer als des. Gerade umgekehrt in meiner Vorstellung. Das cis meines absoluten Tonbewußtseins schwankt in den Mitteln zwischen 574 (579,5) und 580 (586J, das des dagegen zwischen 548 (553) und 566 (571), das gis zwischen 426 (429) und. 427 (430) (Grenzweite 422--434); as dagegen zwischen 417 (420) und 426 (429) [Grenzweite 414 (417)--432 (435)]. Diese auffallende Verschiedenheit ist vielleicht durch den musikalischen Gebrauch zu erklären; das eis leitet oft nach d über, bei eis denke ich meist an die große Septime in d~dur, während ich bei des keine erhöhende Tendenz spüre. Vielleicht ist auch schon die erhöhende Kreuz-Bezeichnung im Gegensatz zu der B-Vorzeichnung die Ursache, daß damit eine höhere Vorstellung verbunden wird.
Die Stimmung des Tonbewußtseins scheint außer von der Übung noch von besonderer körperlicher und geistiger Disposition abzuhängen. So konnte ich an verschiedenen Versuchstagen eine ganz verschiedene Stimmung meines Gehörs bemerken. Hierher gehört vielleicht auch eine Beobachtung, welche mir Prof. Gernsheim bei der Beantwortung meines Fragebogens mitteilte. Herrn Prof. Gernsheim ist es oft nach geistiger Überanstrengung und bei psychischer Depression passiert, daß er ein Orchesterwerk, dessen Tonart er genau wußte, um einen halben Ton zu tief hörte. Da diese Beobachtung sich nur subjektiv feststellen läßt, denn eine Stimmgabel a wird ja auch zu tief gehört, ist es zweifelhaft, ob es sich hier um einen Empfindungs- oder einen Urteils-Fehler handelt. Es ist vielleicht möglich, daß die Empfindungs-Nerven durch Ermüdung fehlerhaft reagieren, obwohl dies nach der Helmholtz'schen Resonatoren-Theorie wenigstens kaum verständlich ist. Eher scheint es sich um einen Urteils-Fehler zu handeln, doch hat die Erklärung auch hierbei seine Schwierigkeit; denn da der Ton a mit dem Buchstaben a bei dem absoluten Tonbewußtsein associiert ist, der Ton as dagegen mit dem Wort as, so müßten in unserem Falle ganz andere Associationen vorliegen, nämlich Ton a mit Wort as verbunden sein; die psychologische Depression würde hier also eine Erhöhung der Grehörsstimmung um einen halben Ton bewirkt haben. Auch der Wille kann auf die Stimmung des absoluten Tonbewußtseins einwirken; mit einiger Energie kann man das absolute Tonbewußtsein sogar um 1/2 Ton höher oder tiefer stimmen und für kurze Zeit (1-- 3 Stunden) so erhalten. Beispiele dafür werde ich später geben.
Wir haben gesehen, daß es auch einen direkten Weg vom Wortbild zum Tonbild giebt, ebenso wie wir ihn zuerst bei der Tonhöhen-Beurteilung in entgegengesetzter Richtung fanden. Da diese Fähigkeit der absoluten Ton-Vorstellung gar nicht gefunden wird, ohne daß nicht gleichzeitig die erste Art des absoluten Tonbewußtseins da ist, es müßten gar mittelbare Kriterien zu Hilfe genommen werden, so nahmen wir an, daß die Reproduktion der Tonhöhe der schwierigere Associationsweg ist, schwieriger als der Übergang von Tonbild zu Wortbild. Wir können dies aber noch an einem andern Faktum erkennen: In dem Paragraphen, der die Urteilszeit der Tonhöhen-Erkennung behandelte, sahen wir, daß nur eine minimale Zeit nötig ist, damit das Tonbild das Wortbild reproduziere. Wenn wir nun jetzt für den umgekehrten Weg die Urteilszeit ausrechneten, dann würden wir finden, daß dieselbe ganz unverhältnismäßig länger dauert. Exakte Versuche habe ich nicht angestellt, weil keine ausreichenden Apparate dafür existieren. Man müßte wieder zur elektrischen Uhr und dem Lippen-Schlüssel greifen, dessen Fehler ich oben schon besprochen habe, und welche hier in derselben Weise wie vorher die Versuchs-Resultate unbrauchbar machen würden. Ein Kontakt-Klavier oder ein analoges Instrument ist hier nicht zu verwenden. Aber man sieht auch ohne exakte Versuchsreihen, daß die Zeit für die Reproduktion des Tones durch das Wortbild bedeutend, vielleicht hunderte von Malen größer ist, als die Zeit der Tonhöhen-Beurteilung. Die Erklärung hierfür dürfte etwa in Folgendem zu suchen sein: Ein Ton ist für uns eine Gehörs-Empfindung bez. Vorstellung, die wir seiner Höhe nach mit bestimmten Buchstaben-Namen zu versehen gelernt haben. Die Ton-Empfindung f wird also mit dem Buchstaben f associiert und mit nichts anderem. Umgekehrt haben wir gelernt, daß dem Buchstaben f eine ganz bestimmte Tonhöhe f entspricht; dies ist aber nur eine Association unter den vielen, die vom Buchstaben f ausgehen; der gehörte Buchstabe mag sich associieren mit dem Schriftzeichen, mit irgend welchen Namen, die mit f anfangen, die Bezeichnung forte wird ja in der Musik auch mit f ausgedrückt, f ist ferner die Abkürzung für fein u. s. w. Kurz die vom Wortbild f ausgehenden Associationen sind sehr zahlreich, und nur eine unter diesen ist die Association mit dem Tonbild. So mag es kommen, daß erst unter den Associationen die Auswahl getroffen werden muß, und daß dazu eine weit größere Zeit erforderlich ist, als zu der obigen. Association vom Ton f zum Zeichen f, die den einzigen Weg bildet.
Die theoretisch und praktisch wichtigste Frage, die man sich bezüglich des absoluten Tonbewußtseins stellen kann, ist diejenige, woher es kommt, daß einzelne Menschen mit der Fähigkeit begabt sind, die meisten aber nicht. Aus dieser entwickeln sich dann wieder zwei Unterfragen:
1) Ist das absolute Tonbewußtsein eine Eigenschaft, die nur auf Grund besonders angeborener physiologischer Verhältnisse zu stände kommt, oder
2) Ist das absolute Tonbewußtsein von normal musikalisch veranlagten Menschen durch besonders darauf gerichtete Übung zu erlernen?
Die meisten Musiker, die man nach der Entstehung ihres absoluten Tonbewußtseins fragt, behaupten, es wäre ihnen angeboren; dies ist natürlich unrichtig, denn kein Kind bringt die Fähigkeit mit auf die Welt, einen Ton als a zu bezeichnen (ein in Italien geborenes Kind müßte dann mit der Fähigkeit geboren werden, denselben Ton la zu nennen). Um einen Ton mit dem für ihn gebräuchlichen Namen bezeichnen zu können, muß man notwendigerweise Ton und Namen in Verbindung mit einander gehört haben. Ob dies genügt und wie oft solch Hören notwendig ist, ist allerdings eine andere Frage und hängt sicher von individuellen Fähigkeiten ab; doch wissen wir dies ja vom Lernen überhaupt.
Wenn man einem Kinde z. B. eine Glocke zeigt und ihm den Namen Glocke dabei nennt, dann wird bei dem Kind nach häufiger Wiederholung das Formenbild der Glocke das Wortbild Glocke reproduzieren und umgekehrt. Dem einen Kinde muß der Gegenstand in Verbindung mit seinem Namen 10 mal, einem zweiten 50 mal vorgeführt werden, damit eine dauernde Association da ist; manches Kind wird trotz vielfacher Wiederholungen die Bezeichnung nicht erlernen, wie wir es bei Idioten, Imbecillen finden oder nach Hirnverletzungen bei sensorieller Aphasie.
Wenn wir unser absolutes Tonbewußtsein in Analogie hiermit betrachten wollen, dann würde allerdings die Idiotie oder die Aphasie in diesem Sinnesgebiet recht verbreitet sein. Darum wollen wir betrachten, welcher Unterschied da obwaltet, weshalb die Bezeichnung eines greifbaren Gegenstandes von den meisten Menschen erlernt wird, die eines Tones von nur wenigen.
Kehren wir wieder zu unserer Glocke zurück; das Kind erhält von der Glocke zunächst eine Gesichts-Wahrnehmung, zweitens, da als wesentlich an der Glocke dem Kinde der Klang vorgeführt wird, eine Gehörs-Wahrnehmung. Drittens kann das Kind sich durch Befühlen und Betasten eine Tast-Wahrnehmung, ja viertens eine Temperatur-Wahrnehmung verschaffen. Selbst von den beiden letzteren unwesentlichen Sinnen abgesehen, sind es doch zwei Sinne mindestens, die beschäftigt werden; die Wahrnehmungen hinterlassen Vorstellungen, zwischen denen dann und dem Bilde des immer dazu genannten Wortes Glocke die Associationen gebahnt werden. Der Unterschied gegen die absolute Tonhöhen-Bezeichnung liegt hier also darin, daß bei der Begriffsbildung eines greifbaren Gegenstandes mehrere Sinne mithelfen, bei dem absoluten Tonbewußtsein nur ein Sinn, der Ton kann nur durch das Gehör wahrgenommen werden (abgesehen von den tiefsten Tönen, die auch mit dem Tastsinn empfunden werden [s. o.]). Wird nun einem Kinde eine Glocke gezeigt, die von der ersten Glocke etwas in der Gestalt abweicht, so wird das Entscheidende für das Kind sein, ob das Ding, welches Glocke genannt wird, einen Klang hervorbringt; d. h. der Gehörsinn wirkt mit, um die unwesentlichen Verschiedenheiten, die der Gesichtssinn bemerkt, zu vernachlässigen oder mit anderen Worten, der eine Sinn hilft dem. anderen zur Bildung einer Allgemeinvorstellung. Bei unserer absoluten Tonhöhe fehlt diese Hilfe vollständig.
Nun giebt es aber Ton-Qualitäten, für welche das Gedächtnis vorzüglich entwickelt ist. Z. B. die Klangfarbe wird von fast allen Menschen nicht nur in Relation zu anderen Klangfarben, sondern absolut im Gedächtnis behalten. Wenn ich einem Menschen verschiedene Instrumente vorspiele. Klavier, Geige, Cello u. s. w., dann wird er leicht die Klangfarbe im Gedächtnis behalten. Weil ich dieselbe Klangfarbe bei vielen Tönen hervorbringen kann, ist es leicht, von den anderen Ton-Qualitäten Höhe und Intensität zu abstrahieren", vor allem aber, weil die Übungsdauer eine weit größere bei der Klangfarbe ist als bei der Tonhöhe, kann diese viel eher im Gedächtnis behalten werden. Wir hören einen ganzen Abend Klavier-Musik und haben so stundenlang Gelegenheit, uns die Klavier-Klangfarbe einzuprägen; einen Ton a hören wir dagegen in der Musik nur kurze Zeit und können auch in besonders darauf gerichteter Übung das Hören eines einzelnen Tones nicht allzulange ausdehnen. Ein anderer Umstand, der auch in Betracht kommen könnte, ist, daß wir bei der Beurteilung der Klangfarbe Bezeichnungen anwenden, die aus anderen Sinnesgebieten hergeleitet sind; wir nennen einen Klavierton schlagartig, den Cello-Ton näselnd und geräuschhaltig. Sicherlich brauchen wir diese Bezeichnung nicht, um die Klangfarbe im Gedächtnis zu behalten, aber möglicherweise findet doch ein unbewußtes Vergleichen mit anderen Sinnes-Eindrücken statt und erleichtert so das Gedächtnis für die Klangfarbe.
Ich glaube dies speziell deshalb, weil ich bei der Vergleichung des absoluten Tonbewußtseins mit dem absoluten Farben-Bewußtsein auf analoge Verhältnisse gestoßen bin; das absolute Farben-Bewußtsein scheint verbreiteter zu sein als das absolute Tonbewußtsein; sehr feine Farben-Unterschiede werden erkannt und Farben-Nuancen in der Vorstellung durch den bloßen Namen der Farbe gut reproduziert. Wie fein die Farben-Unterschiede sein müssen, um dem Tonbewußtsein analoge Verhältnisse zu schaffen, welche Distanzen dort den Halbtönen entsprechen, ist allerdings noch nicht erforscht. Es läßt sich dieses aber erreichen, wenn man als Maßstab die Unterschieds-Empfindlichkeit nimmt und mit ihr das Gedächtnis vergleicht. Ich habe nun bei mir und vielen anderen beobachtet, daß vielfach, wenn eine Farbe vorgestellt werden soll, irgend ein bestimmter Gegenstand, der diese Farbe trägt, mit reproduziert werden muß. Mir ist es z. B. unmöglich, mir eine hellgrüne, braunrote oder hellblaue Farbe rein als Farbe vorzustellen, etwa als gefärbte Tafel. Bei gelbgrün muß ich an Frühlingsrasen, bei braunrot an eine Portiere in meinem Zimmer denken, bei hellblau an das Centralblatt für Gynäkologie, welches einen hellblauen Einband trägt.
In dieser Weise gelingt mir die Farben-Vorstellung vorzüglich. Daher glaube ich, daß dieses gegenständliche Reproduzieren bedeutend zur Entwicklung eines absoluten Farben-Bewußtseins mithilft; schon daher ist es vielleicht häufiger anzutreffen als das absolute Tonbewußtsein. Außerdem ist aber wieder wie bei der Klangfarbe in noch verstärktem Maße die längere Dauer der Sinnes-Empfindung und die dadurch bedingte größere Übung im Farben-Erkennen von Wichtigkeit. -- Die mittelbaren Kriterien, die für die absoluten Tonhöhen-Bestimmungen herangezogen werden können, sind, wie wir oben sahen, meist unsicher und beziehen sich vor allem immer nur auf einen Ton, können daher in ihrer Wirkungsweise nicht verglichen werden mit den Kriterien bei der Farben-Erkennung. Wir sehen also, daß für das absolute Tonhöhen-Urteil kaum helfende Momente herangezogen werden können, und daß es die Aufgabe ist, die Tonhöhe allein im Gedächtnis zu fixieren; wenn also somit das absolute Tonbewußtsein schon bedeutend seltener zu finden ist als andere Gedächtnis-Gegenstände, so wird dieser Unterschied noch erheblich verstärkt durch Momente, welche die Entwicklung des absoluten Tonbewußtseins stören, ja verhindern können.
Betrachten wir einmal, wie eigentlich ein Kind seine musikalische Erziehung erhält. In den ersten Lebensjahren geht die Anregung von der Mutter aus, in zweiter Linie kommen Vater und Geschwister. Die Mutter singt das Kind mit einem Wiegenlied in Schlaf; hat das Mittel einmal seine Wirkung gethan, dann wird es täglich wiederholt. Wenn nun die Mutter nicht zufällig ein absolutes Tonbewußtsein hat und nicht speziell darauf achtet, immer dieselbe Tonart zu gebrauchen, dann singt sie das Lied einmal in c-dur, dann in h-dur etc., ganz nach ihrer jeweiligen Stimmlage; außer der Mutter singen auch der Vater und die Geschwister, die alle verschiedene Kehlköpfe haben, das Wiegenlied und gebrauchen gemäß der verschiedenen Stimmbänder-Länge wieder andere Tonarten. Auf diese Weise kann beim Kind ein Intervall-Sinn ausgebildet werden, kein absolutes Tonbewußtsein. Kommt das Kind in den Kindergarten oder die Schule, dann lernt es die ersten Lieder zwar nach Klavier-Begleitung und Geigenstimmung. Hat ein Kind sich ein Lied aber kaum eingeprägt, so wird es zu Hause aufgefordert, das Gelernte vorzusingen, die Mutter intoniert, um es dem Kinde leicht zu machen, den Anfang wieder in einer ganz willkürlich gewählten Tonart. Schließlich differieren auch die Klaviere und andere Instrumente so erheblich in der Stimmung (bis einen Ganzton und darüber), daß auch in späteren Lebensjahren Momente da sind, die eine Entwicklung des absoluten Tonbewußtseins hindern zu Gunsten des Intervall-Bewußtseins. So gab mir Herr Professor Dessoir an, daß er durch verschiedene Geigenstimmung sein früher sehr gutes Tonbewußtsein, allerdings experimenti causa, verschlechtert habe. Wenn also solch Grund ein bestehendes Tonbewußtsein verschlechtern kann, um wie viel mehr kann er die Entwicklung eines Tonbewußtseins hindern!
Schließlich giebt es Gesangsunterrichts-Methoden, nach welchen der Schüler jeden Ton nach der Stellung, die dieser in der Tonleiter einnimmt, benennt. Entweder in Zahlen 1, 2, 3, 4 oder als do, re, mi. Wenn nun do einmal in c-dur c bedeutet und dann wieder in e-dur e, dann ist es klar, daß damit jede absolute Individualität des Tones aufgehoben wird.
Es wird also eigentlich in der musikalischen Erziehung alles gethan, um die Entwicklung eines absoluten Tonbewußtseins zu hemmen, und so gut wie nichts, um es anzuerziehen.
Einzelne Musiklehrer haben sicherlich versucht, ihren Schülern nebenbei auch ein absolutes Tonbewußtsein anzuerziehen. Leider aber hat keiner statistische Angaben über die Resultate, meist auch nicht einmal über die Lehrmethode gemacht. Nur Naubert[28] hat meines Wissens seinen Lehrplan veröffentlicht, leider aber auch ohne Angabe der Erfolge; trotzdem sind Naubert's Mittheilungen sehr wertvoll. N. schlägt vor, zunächst den Ton a auf einem richtig gestimmten Klavier möglichst oft dem Schüler vorzuspielen und von ihm nachsingen zu lassen. Dann soll der Schüler möglichst oft sich willkürlich den Ton a zu reproduzieren versuchen und den reproduzierten Ton immer mit dem Klavier-a vergleichen. So würde dieser Ton nach mehr oder weniger langer Übung dem Gedächtnis eingeprägt. Sobald dies der Fall ist, wählt N. einen anderen Ton, dessen charakteristischer Klang trotz seiner Verwandtschaft zu a eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit garantiert, z. B. c; später, wenn dies c jm Gedächtnis »unverrückbar feststeht« es. Zunächst experimentiert N. nur in einer Oktave und behauptet, daß, sobald die erwähnten drei Töne. reproduziert werden können, das absolute Tonbewußtsein für eine ganze Oktave geschaffen sei. Dann versucht N., Akkorde und Tonarten einzuüben, und läßt gleichzeitig scharf auf den Klangcharakter der einzelnen Tonarten achten. Wenn auch vieles in Naubert's Ausführungen anfechtbar ist, so gebührt ihm doch das Verdienst, eine Methode angegeben zu haben, die, wie er leider nicht statistisch ausführt, verschiedentlich zu dem erwünschten Ziele geführt hat.
In mehr wissenschaftlicher Form und mit genauem statistischen Material hat M, Meyer die Erlernbarkeit des absoluten Tonbewußtseins untersucht in seiner Arbeit: Is the memory of absolute pitch capable of development by training?[29] M. stellt sehr präzis die theoretisch wichtige Frage an die Spitze seiner Arbeit: Sind die Menschen in zwei Klassen geteilt, deren eine im Besitz eines Gedächtnisses für absolute Tonhöhen ist, während der anderen diese Fähigkeit mangelt, oder besteht nur ein gradueller Unterschied im Tongedächtnis? Wenn das erstere der Fall wäre, so müßten wir bestimmte physiologische Eigenschaften annehmen, an welche die Fähigkeit der absoluten Tonhöhen-Erkennung geknüpft ist; ist aber das zweite der Fall, daß nur ein gradueller Unterschied im Tongedächtnis besteht, dann muß dieses durch Übung eventuell gebessert werden können, aber man muß dann auch schon die Fähigkeit, mit welcher ein Wenig-Musikalischer die Töne einer Geige als hoch, die eines Basses als tief bezeichnet, ein Gedächtnis für absolute Tonhöhen nennen. J. v. Kries hat in seiner Arbeit »Über das absolute Gehör«[30] diese Unterscheidungs-Fähigkeit für hoch und tief getrennt von dem absoluten Gehör, wie er die Fähigkeit der absoluten Tonhöhe-Bestimmung nennt, und sagt, man könne erst von absolutem Gehör sprechen, wenn der ev. Fehler nicht 2--3 Halbtöne überschreitet. -- Meyer machte nun in Gemeinschaft mit Dr. Heyfelder Versuche, welche zeigten, daß durch systematische und andauernde Übung ein mäßiges Tonhöhen-Gedächtnis derart verbessert werden kann, daß keine größeren Fehler als die der 3 Halbtöne der Kries'schen Forderung mehr vorkämen. Die Versuche wurden mittelst Stimmgabel-Tönen und Klavier-Tönen angestellt, welche nicht nach ihrem musikalischen Namen, sondern nach ihrer Schwingungszahl benannt wurden. Zuerst wurden nur wenige Tonhöhen und große Intervalle genommen, 10 Töne im Intervall von Sexten, dann 20, welche um eine große Terz, schließlich 39, die nur um einen Ganzton von einander entfernt waren. Bei diesen letzten Versuchen verzeichneten die Beobachter immer noch 60% richtige Urteile und Fehler, die nur selten mehr als einen Ganzton betrugen. Aus diesen Versuchen schließt M., daß das Gedächtnis für absolute Tonhöhen zu bessern ist, und daß nur ein quantitativer, nicht qualitativer Unterschied bei den verschiedenen Individuen besteht.
Die Fähigkeit, welche v. Kries das »absolute Gehör« nennt und welche unserem absoluten Tonbewußtsein entspricht, ist aber eine besondere Art des Tongedächtnisses; wir sahen, daß die Hauptsache die Association zwischen Tonbild und Wortbild ist (meiner Ansicht nach darf der Fehler höchstens einen halben Ton nach beiden Richtungen hin betragen). Diese Association macht das absolute Tongedächtnis zu einer dauernden Fähigkeit; fehlt sie, dann geht jedes Tonhöhen-Gedächtnis nach kurzer Zeit des Übungsmangels wieder zu Grunde. So ist auch bei Meyer und Heyfelder die Fähigkeit der Tonhöhen-Erkennung bald wieder völlig verschwunden, wie er selbst angiebt; da er gar nicht Tonnamen und Tonhöhe gleichzeitig zu Gehör gebracht hat, konnte sich auch die Association zwischen beiden nicht ausbilden. -- Jedenfalls sind die Meyerschen Versuche sehr interessant und bilden, namentlich zusammen mit den Naubert'sehen Vorschlägen, eine Stütze für die Ansicht, daß das absolute Tonbewußtsein durch Übung zu bessern, beziehungsweise zu gewinnen ist. Auch nach meinen Erfahrungen möchte ich dies als sicher aussprechen", es handelt sich somit nicht um eine hypothetische Frage, sondern eine reale, für die praktische Musik wichtige, pädagogische Angelegenheit.
Für die Frage der Erlernbarkeit des absoluten Tonbewußtseins muß man zunächst die beiden Hauptgruppen desselben scharf aus einander halten, d. h. die Reproduktion des Wortbildes durch das Tonbild und die Reproduktion des Tonbildes durch das Wortbild.
Um ein Ding wiederzuerkennen, muß man es häufig wahrnehmen und die Aufmerksamkeit auf dasselbe richten. Man kann die Aufmerksamkeit um so leichter auf einen Gegenstand konzentrieren, je weniger sie von anderen Dingen abgelenkt wird. Um daher eine bestimmte Tonhöhe a wieder zu erkennen, muß man den Ton a möglichst oft dem Ohre vorführen, nicht in Zusammenhang mit anderen Tönen, sondern isoliert. Der Klang a hat aber außer der Tonhöhe noch andere Qualitäten, die der Dauer, der Intensität und der Klangfarbe. Die Tondauer kommt unter gewöhnlichen Umständen hierbei wohl nicht in Betracht, aber die Tonstärke und die Klangfarbe ziehen häufig die Aufmerksamkeit derart auf sich, daß für die Hauptqualität, die Tonhöhe, nicht genügend übrig bleibt. Man achte also, wenn man eine Tonhöhe im Gedächtnis behalten will, darauf, die Nebenqualitäten immer gleichartig zu gestalten, d. h. den Ton stets in derselben Klangfarbe ertönen zu lassen. Das Optimum der Tonstärke ist schwer zu bestimmen. Zu große Intensität kann physikalisch bedingte Schwierigkeiten (Nebengeräusche) verursachen; bei ganz schwachen Tönen muß manchmal erst ein Existentialurteil gefallt werden. Das Optimum liegt also zwischen ihnen. .Eine Intensität, bei welcher der Ton gerade deutlich wahrgenommen wird, scheint am besten geeignet zu sein, daß die Aufmerksamkeit von ihr abgelenkt werden kann.
Noch weit wichtiger ist es, die Aufmerksamkeit von der Klangfarbe ab dem Grundtone zuzuwenden. Wir sahen oben, daß man sich für ein absolutes Höhenurteil die Klangfarbe analysieren muß, indem man entweder den Grundton oder eine Einheit heraus isoliert, je nachdem der Beobachter auf einem Musikinstrumente vorwiegend spielt (Klavierton-Einheit). Ich würde deshalb einen Schüler, der noch keinen oder geringen Instrumentalunterricht genossen hat, oder der häufig akustische Untersuchungen mit Stimmgabeln gemacht hat, erst sich Stimmgabeltöne einprägen lassen; diese sind fast obertonlos, und so kann die. Aufmerksamkeit am wenigsten durch den Klangcharakter abgezogen werden. Hat aber ein Musiker Jahre lang Klaviermusik getrieben, so hat sich in ihm die Klavierton-Einheit festgesetzt, d. h. Klaviertöne hört er als einfach; alle anderen noch oberton-ärmeren Klänge würden ihm fremd vorkommen, d. h. ihr Klang-Charakter würde die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Daher muß solch Schüler in Klaviertönen unterrichtet werden, wenigstens für den Anfang, bis er diese Klänge beurteilen kann. Zunächst bleibe man bei dem einen Klang a, lasse den Ton oft mit gespannter Aufmerksamkeit anhören und jedesmal den Buchstaben a dabei sagen oder denken. So gelingt es oft, diese Association zu bewerkstelligen; später geht man dann zu anderen Klangfarben über, aber immer bei demselben Grundton a. So haben von den 100 Beantwortern meines Fragebogens nicht weniger als 9 ihr absolutes Tonbewußtsein auf diese Weise erreicht, 6 indem sie Stimmgabeln und Stimmpfeifchen bei sich führten und möglichst oft den Ton erklingen ließen und mit ihrem reproduzierten Ton verglichen; drei hatten die Versuche am Klavier angestellt. Einem kleinen 6jährigen Knaben, der sehr musikalisch begabt war, aber kein absolutes Tonbewußtsein besaß, schenkte ich ein Stimmpfeifchen und lehrte ihn, es richtig zu gebrauchen; ich fand zu meiner Freude, daß er nach 1/2 Jahre im stande war, regelmäßig nicht nur das a, sondern auch andere Töne richtig auf Kommando zu singen; in der Wiedererkennung war er weniger sicher. Hat ein Schüler erst das a fest im Gedächtnis, oder erkennt er es immer wieder, dann kann er mit diesem partiellen absoluten Tonbewußtsein und mit Hilfe des Intervall-Sinns jede Tonhöhe beurteilen und sich entweder so durch Übung auch für die anderen Tonhöhen ein absolutes Tonbewußtsein aneignen, indem der Intervall-Sinn allmählich ausgeschaltet wird, oder es sind dann noch andere Töne direkt zu üben; am besten halte ich, erst alle a einzuüben a0, a1 a2, a3 u.s.w.
Dadurch wird gleich die Aufmerksamkeit auf die Klang-Verwandtschaft der Oktaven gelenkt werden. Dieser Versuch würde zuerst am besten bei oberton-reichen Klängen angestellt werden, weil die Oktave bei diesen noch stärkere Klang-Verwandtschaft hat, als bei obertonlosen Tönen. Dann wird also, sobald das «immer wieder erkannt wird, das a2, a3 u. s. w. an seiner Klang-Verwandtschaft mit a (ohne Intervall-Vergleichung) erkannt und schließlich auch absolut beurteilt. Ich halte speziell die Oktaven zur Übung für geeignet, weil ich aus meinem Fragebogen die Überzeugung gewonnen habe, daß sich den meisten mit absolutem Tonbewußtsein »begabten Personen die Klangfarbe der Oktaven aufdrängt, und daß wir in diesem Ähnlichkeits-Gefühl wahrscheinlich für die Entwicklung des absoluten 'Tonbewußtseins einen wichtigen Faktor sehen müssen. Ich erinnere an die oben angeführten Bemerkungen über Oktaven-Täuschungen. Auch von anderen Forschern, namentlich von Kries wurde dies hervorgehoben.
Dann, wenn die a in ihrer absoluten Höhe erkannt werden, würde ich mit Akkord-Übungen (Dreiklängen) beginnen, dem a-dur, dem f-dur und dem d-dur Dreiklang: Nehmen wir an, daß in diesen Dreiklängen das a absolut erkannt wird, so wird der Akkord aus der jeweiligen Stellung, die das a in ihm einnimmt, mit Hilfe des Intervall-Sinns beurteilt werden. Dadurch wird die Freude und das Interesse des Schülers stark erregt und die Aufmerksamkeit auf die anderen Töne des Dreiklangs gelenkt, so daß diese bald nicht mehr des Intervall-Sinnes bedürfen, sondern in ihrer absoluten Höhe erkannt werden können. -- Nach den Dreiklängen kämen andere Akkorde zur Übung, wenn das absolute Tonbewußtsein dann nicht schon ein allgemeines geworden ist.
Es ist dies alles eine Übung, die viel Zeit und Fleiß von Seiten des Lehrers und Schülers erfordert. Die Erfolge werden sehr verschiedene sein, je nach der Begabung des einzelnen. Der eine braucht kürzere, der andere längere Zeit, mancher lernt's nie, auch bei sonstigen musikalischen Fähigkeiten; diesen aber, und das halte ich für die Hauptsache, würde ich nicht als Schüler aufgeben, sondern ihn nach der zweiten Methode zu unterrichten versuchen.
Diese zweite Methode bezweckt, die zweite Art des absoluten Tonbewußtseins zu lehren, die in einer Reproduktion des Tonbildes durch das Wortbild besteht. Wie wir oben sahen, kommt diese Reproduktion, wenn nicht auch der umgekehrte Associationsweg funktioniert, nur zu stande unter Mithilfe von mittelbaren Kriterien. Der Plan dieser zweiten Methode ist also einfach der, den Schüler zu veranlassen, wenn Methode A versagt, unter Zuhilfenahme von mittelbaren Kriterien sich eine Ton-Reproduktion zu ermöglichen. Ist diese erst da, dann kann durch fortgesetztes Üben auch die Fähigkeit der Ton-Erkennung entstehen.
Man müßte also zuerst sehen, wie sich der Schüler in Bezug auf diese Kriterien verhält. Wir sahen, daß von verschiedenen Sinnen, die hierbei in Betracht kommen können, vor allem der Gesichtssinn und der Muskelsinn zu nennen sind. Wir fanden, daß sich der eine Musiker, um sich eine Tonhöhe vorzustellen, das Notenbild, ein zweiter das Klaviertasten-Bild, ein dritter eine ganze Scenerie reproduziert. Das wären alles Kriterien, gewonnen durch Association des Gehörsinnes und Gesichtssinnes. Ebenso wichtig sind aber die Vorstellungen, die den Muskelsinn betreffen. Kehl kopfmuskel-Empfindungen resp. Kontraktions-Vorstellung en haben wir schon eingehend besprochen. Wie für den Sänger dieses Hilfsmittel, ist für den Geiger die Bewegungs-Vorstellung seiner Finger, seiner Hand beim Niederdrücken einer Saite von Bedeutung. Bekannt ist, daß diese Bewegungs-Vorstellung das Reproduzieren einer Melodie wesentlich erleichtert, weniger bekannt dürfte die erwähnte Beziehung zum absoluten Tonbewußtsein sein.
Wenn nun der Schüler von selbst keine Neigung, mittelbare Kriterien anzuwenden, bekundet, so muß der Lehrer versuchen, ihn willkürlich zu diesen Vorstellungs-Verbindun'gen hinzulenken. Damit aber nicht unnütze Zeit und Mühe vergeudet wird, ist es gut, sich vorher zu orientieren, welcher Art die meisten Gedächtnisbilder des Schülers auch im nichtmusikalischen Bereiche sind, ob sie vorwiegend akustischer, visueller oder motorischer Natur sind. Zur Prüfung dieser Vorfrage lasse man, wenn man nicht exaktere Untersuchungen mittels geeigneter Apparate machen kann, einen psychologisch allerdings ziemlich rohen Versuch machen. Man lasse den Schüler an irgend ein ihm bekanntes Gedicht denken oder ihn im Kopfe rechnen und lasse ihn selbst den psychologischen Vorgang beschreiben. Der eine wird sich das Gedicht innerlich aufsagen oder gar schreiben, ein zweiter stellt sich die Verse von einem anderen deklamiert und sich selbst hörend vor, ein dritter liest im Geiste die Wörter; analog wird letzterer gleichsam schriftlich im Kopfe rechnen, d. h. sich die Zahlen geschrieben denken, der erste würde die Zahlen selbst schreiben oder innerlich sprechen und der zweite sie innerlich hören. Hat man durch verschiedene Versuchsreihen festgestellt, welcher Art die Lieblings-Associationen des Schülers sind, so ist vielleicht ein Schluß und eine praktische Anwendung auf das Tongedächtnis gestattet. Die Richtigkeit könnte nur eine längere diesbezügliche Untersuchung an zahlreichen Schülern beweisen: Man lasse dann den Visuellen zugleich mit dem Erklingen des Tones das Tastenbild sehen oder die entsprechende Note oder die ganze Scenerie. Welches von diesen Bildern ausgewählt werden soll, ist schwer zu sagen; meist wird man sich mit dem Tasten- und Notenbild begnügen müssen.
Man gebe also dem Schüler einfach den Rat, sich so oft wie möglich einen Ton a anzuschlagen und dabei auf Gehörs- und Gesichts-Eindruck zu achten, und beim Ansehen der Taste immer zu versuchen, sich das Gehörsbild vorzustellen. Kommt man damit nicht zum Ziele, so lege man dem Schüler ein Notenblatt vor, am besten die Noten eines Liedes, das mit dem einzuübenden Ton a beginnt. Man gebe ihm dann den Ton a, auf dem Klavier z. B., an und lasse ihn wieder Ton- und Gesichts-, d. h. Notenbild einprägen. Ich kenne verschiedene Musiker, die beim Ansehen der Noten gleich den richtigen Ton reproduzieren können, ohne dies aber nicht. Die im Kapitel der mittelbaren Kriterien angegebenen Beispiele meines Fragebogens dürften als Beweismaterial für die Zweckmäßigkeit dieser Methode gelten.
Hat man es so weit gebracht, daß die Gesichts-Empfindung die Ton-Vorstellung reproduziert, dann versuche man, ob die central erregte Gesichts-Vorstellung, d. h. das willkürlich vorgestellte Notenbild ebenfalls schon genügt, die Association zu bewerkstelligen. Man gebe also dem Schüler auf, wenn er einen bestimmten Ton singen soll, immer an das Noten-, Tastenoder scenische Bild, in dessen Verbindung er den Ton geübt hat, zu denken. Auf diese Weise kann man viele (wahrscheinlich ausgeprägt visuelle Naturen) dahin bringen, sich einen Ton richtig zu reproduzieren. Kann der Schüler dies, dann braucht er noch nicht im stande zu sein, jedes a in einem Tonwerk als a zu erkennen. Das wird erst nach langer Übung eintreten, wenn die Association nicht mehr, wenigstens nicht mehr bewußt, für die Ton-Reproduktion erforderlich ist.
Bei den motorisch denkenden Schülern kommt man auf diese Weise noch nicht zum Ziele; in ihnen muß man Associationen des Tonsinns mit Bewegungs-Vorstellungen zu wecken versuchen. Den Geiger, der sich ein a reproduzieren soll, lehre man, nach den entsprechenden eben erwähnten Vorversuchen, daran zu denken, wie er die Geige stimmt, sich die Bewegungen seiner rechten und linken Hand, die er dabei macht, vorzustellen. Da hierbei die leere a-Saite gerade keine besonders charakteristische Handbewegung erfordert und die Haltung des rechten Armes in der Weise, daß «nur die a-Saite gestrichen wird, nicht genügend bestimmt ist und während des Streichens variiert, so ist es vielleicht zweckmäßiger, an die Bewegung zu denken, welche der Geiger macht, wenn er das a auf der d- Saite in der 3. Lage mit dem 2. Finger spielt. In ähnlicher Weise verfahre man bei den Sängern, sie lasse man die Kehlkopfmuskel-Empfindungen beziehungsweise Vorstellungen zu Hilfe nehmen und analog bei den anderen Instrumentalmusikern. In meiner durch den Fragebogen gewonnenen Statistik fanden sich 5 Beobachter, welche zu einer Tonreproduktion sich den Anfangston eines ihnen geläufigen Liedes selbst singend vorstellen mußten.
Schüler, welche rein akustische Gedächtnisbilder haben, sind wahrscheinlich gar nicht nach Methode B, sondern nach Methode A zu unterrichten. Daher ist, wenn dieser Schluß von der Natur der Gedächtnisbilder sich in der Praxis als richtig erweist, vielleicht zweckmäßig, jeden Unterricht in der Erlernung des absoluten Tonbewußtseins damit zu beginnen, die Art der Gedächtnisbilder zu prüfen und danach erst Methode A oder B auszuwählen und die entsprechenden Unterabteilungen.
Erheblich leichter als bei dem erwachsenen Schüler gestaltet sich der Unterricht in der Tonhöhen-Bestimmung bei Kindern. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, daß die Hauptschwierigkeit für die Entwicklung des absoluten Tonbewußtseins der musikalische Unterricht in der Kindheit, der nur den Intervallsinn berücksichtigt, bildet. Wenn man ein Kind daran gewöhnen würde, einen Ton oder eine Melodie stets in derselben Tonart zu hören, dann würde das Kind sich viel leichter ein Gedächtnis für die absolute Tonhöhe aneignen können als jetzt, da alles gethan wird, das absolute Tonbewußtsein zu unterdrücken. Stumpf berichtet in seiner Tonpsychologie von einem 18 Monate alten Knaben, der darauf dressiert war, auf Kommando den Ton c richtig zu singen. -- Über ein absolutes Tonbewußtsein in so jugendlichem Alter habe ich allerdings keine Erfahrung, kenne aber viele, und ich selbst gehöre zu diesen, welche bereits im 5. Jahre alle Klaviertöne benennen konnten. Ich habe nun einige praktische Versuche gemacht, kleinen Kindern ein absolutes Tonbewußtsein anzuerziehen. Die kleinen Schüler waren drei Mädchen, zwei im Alter von vier, eins im Alter von drei Jahren. Die eine der 4jährigen hatte schon im Kindergarten einige Lieder gelernt. Die beiden anderen hatten noch gar keine musikalische Anregung erhalten und stammten aus Arbeiter-Familien, in denen die Mutter wenig Mühe und Zeit auf die Kinder-Erziehung verwenden kann und ihnen auch nach eigener Angabe kaum jemals etwas vorgesungen hat. Diese drei Kinder besuchten mich immer zusammen, und darum unterrichtete ich sie auch gemeinsam. Ich sang ihnen das Wort ade in den Tonhöhen «A0 D0 vor; die Kinder sangen dann sofort Wort und Töne richtig nach, und zwar transponiert in ihre Stimmlage als a1 d1. Dies wiederholte ich 6 Tage lang hinter einander und sang ihnen an jedem Tage zehn mal die Töne vor und ließ sie eben so oft gleich nachsingen; am 7. Tage nahm ich jedes Mädchen einzeln und sagte ihm: Singe einmal ade, d. h. ich sprach nur das Wort ade aus. Zwei der Kinder trafen die Tonhöhe «a1 d1 ganz scharf, die dritte sang zwar auch eine richtige Quinte, doch c2 f1 und bei weiteren Wiederholungen nach längeren Pausen b1 es1, ja es2 as1. Dieses dritte Kind war gerade das, welches schon im Kindergarten Musik getrieben hatte. Die beiden anderen behielten ihr Gedächtnis für a1 d1 vorzüglich bei. Nach Pausen von 14 Tagen bis zu einem Vierteljahr waren sie stets im stande, die richtigen Tonhöhen zu reproduzieren, und irrten sich nie (30 Versuche mit 100% richtigen Fällen), während das dritte Kind neun richtige Fälle, d. h. 30% aufwies; bei allen Kindern mußte die associative Fähigkeit jedesmal erst durch ein Stück Chocolade angeregt werden. Zufällig traf ich die eine der Kleinen vor kurzer Zeit auf der Straße, d. h. l 3/4 Jahr nachdem ich die letzten Versuche mit ihr angestellt hatte, und prompt sang sie mir auf das ade-Stichwort die richtigen Tonhöhen a1 d1. -- Ein vierter kleiner Schüler ist schon bei Besprechung der ersten Methode erwähnt worden. Jedenfalls scheint bei Kindern die Erweckung des absoluten Tonbewußtseins bedeutend leichter zu sein als bei Erwachsenen; allerdings müßte erst von beiden statistisches Material gesammelt werden, um wirksame Schlüsse ziehen zu können. Sehr zweckmäßig wäre es, wenn diese Hörversuche einmal im Großen in Blinden-Anstalten angestellt würden, da gerade die Blinden durch ihr Leiden akustische Eindrücke mit weit größerer Aufmerksamkeit aufnehmen als normale Menschen.
Selbst bei Tieren habe ich ein absolutes Gehör konstatieren resp. entwickeln können. Ich hatte einen Papagei, dem ich Lieder stets in derselben Tonart vorpfiff; er war so gelehrig, die Melodien bald wieder nachpfeifen zu können, und zwar ebenfalls immer in derselben Tonart. So begann er den Anfang der (C-moll-Symphonie stets richtig mit g g g es. Nur einmal fing er diese Töne zu hoch zu pfeifen an, mit as\ brachte aber nur die drei as hervor und fing dann wieder von vorn an in der richtigen Tonhöhe g. Ob der Vogel hierbei mit Hilfe von Muskel-Empfindungen seiner dicken Zunge oder durch sonstige mittelbare Kriterien zu seiner Tonhöhen-Reproduktion gelangt, ist natürlich nicht zu ermitteln. -- Auch ein Staar, den ich mir kurz nach dem allzu frühen Tode des hoffnungsvollen Papageis anschaffte, gebraucht stets dieselbe Tonart für sein Lied, in der es ihm vorgepfiffen war.
Meine Resultate schließen sich also den Erfahrungen der oben erwähnten Forscher Naubert und Meyer wohl an, und auch andere Musik-Pädagogen wie Prof. Jadassohn in Leipzig haben praktisch erkannt, daß ein absolutes Tonbewußtsein bei einer ganzen Anzahl von Menschen anzuerziehen ist. Weitaus die meisten, die sich jetzt eines absoluten Tonbewußtseins erfreuen, haben dieses allerdings ohne besonders darauf gerichtete Übung erlangt, doch braucht man bei diesen a priori keine anderen physiologischen Verhältnisse annehmen, sondern kann denken, daß nur die für das Erlernen nöthige Zeit und die Art der Übung eine etwas andere war. Jedenfalls aber muß ein gewisser individueller Faktor schuld sein, daß gewisse Menschen ohne besondere Übung, andere mit Übung, noch andere gar nicht im stande sind, Tonhöhen zu benennen und sich vorzustellen[31].
Man muß nun betrachten, welcher Art wohl dieser individuelle Faktor sein könnte. Nahe liegt es, anzunehmen, daß unsere Fähigkeit in Zusammenhang stehe mit einer besonderen Feinheit des Empfindungs-Apparates, derart, daß mit absolutem Tonbewußtsein begabte Musiker die einzelnen Ton-Qualitäten in ihren Mindestmaßen und feinsten Unterschieden besser erkennen können als andere Menschen. Da würde also Tonstärke, Tondauer und Tonhöhe in Betracht kommen, und zwar in Bezug auf Unterschieds-Empfindlichkeit und auf höchste und tiefste Tongrenzen. Die meisten dieser Punkte sind schon bei den früheren Abschnitten behandelt worden. Ich habe nicht finden können, daß eine besondere Empfindlichkeit für Tonstärken, sowohl für absolute wie für relative Intensität, irgend welche Beziehung zeigt zum absoluten Tonbewußtsein; dieselbe wäre auch kaum denkbar, weil, wie ich oben ausführte, zur Bildung des absoluten Tonurteils ein Stärkemaß nötig ist, welches weit über der Intensitäts-Schwelle liegt. Auch die Dauer-Schwelle kommt nicht für unsere Frage in Betracht. Bei der mit Dr. Brühl gemeinsam ausgeführten Arbeit[32] über kürzeste Töne und Geräusche konstatierten wir für uns beide eine völlig gleiche Dauer-Schwelle, obwohl der eine von uns ein absolutes Tonbewußtsein besitzt, der andere nicht. Auch in den mit Dr. Schäfer vollführten Versuchen trat die von uns so genannte Triller-Schwelle bei uns beiden gleichzeitig ein, obwohl auch Dr. Schäfer kein absolutes Tonbewußtsein besitzt. Was jetzt die Tonhöhe anbetrifft, so sahen wir schon, daß die Höhen- und Tiefengrenze für absolute Höhen-Beurteilung viel näher zusammen liegen als für die Empfindung. Es ist daher schon a priori unwahrscheinlich, daß die Empfindungs-Grenzen für das Höhen-Urteil von Bedeutung sein können, zweitens hängen die Empfindungs-Grenzen stark von physiologischen Alters-Veränderungen des Gehörorgans ab, während diese Faktoren das absolute Tonbewußtsein nicht zu tangieren scheinen. Auch die Unterschieds-Empfindlichkeit scheint nicht von Wert für das absolute Tonbewußtsein zu sein, wie schon oben gesagt wurde, es ist auch nicht wahrscheinlich, weil das Unterschieds-Gedächtnis so viel größerer Distanzen bedarf als die Empfindung.
Einen zweiten Grund könnte der individuelle Koefficient, welcher zur Erlangung des absoluten Tonbewußtseins prädisponiert, in gewissen anatomischen Verhältnissen haben. Wir könnten uns vorstellen, daß bei dem einen bestimmte Gehirnteile vorhanden sind, durch deren Funktion das absolute Tonbewußtsein zu stande kommt, während diese Teile bei einem anderen entweder fehlen oder funktionsunfähig sind Die Theorie der Vererbung würde diese Frage nur in eine frühere Generation verschieben; im übrigen habe ich durch meine Fragebogen mich nicht überzeugen können, daß die Vererbung von wesentlichem Einfluß für das absolute Tonbewußtsein ist. Mehr als die Hälfte der Beantworter meines Fragebogens gab an, daß in der Familie kein absolutes Tonbewußtsein und auch keine sonstige besondere musikalische Eigenschaft bestände.
Von der Anatomie der Hörsphäre wissen wir leider herzlich wenig, wir wissen, daß es ein akustisches Centrum giebt, welches nach Munk, Vernicke, Thaller und Pick in der ersten Windung des Schläfenlappens zu suchen ist. Durch Tierversuche glaubte Munk[33] sogar besondere Centren für hohe und tiefe Töne zu finden, und zwar sollte die hintere Partie der Hörsphäre, in der Nähe des Kleinhirns gelegen, den tieferen, die vordere in der Nähe der fossa Sylvii den höheren Tönen entsprechen. Da wegen der großen Schwierigkeiten der Tierversuche, vor allem wegen der oft fehlerhaften Deutung der Reaktionen, diese Resultate mit großer Vorsicht zu betrachten sind, so sind sie vollends nicht für unsere Frage nach den Centren des absoluten Tonbewußtseins zu verwerten. Alles Physiologische, was bisher über Höhen-Centren veröffentlicht wurde, betraf nur die Empfindungs-Centren für Töne. Wir müßten aber außer diesen noch mindestens Gedächtnis-Centren annehmen, welche sich wieder teilen müßten in ein Gedächtnis-Centrum für absolute Tonhöhen, eines für Intervalle, eines für Melodien u. s. w.; kurz der ganze Gehörssinn müßte in zahlreiche Einzelcentren untergebracht werden; leider hat die Physiologie und auch die Pathologie hier noch sehr wenig weiter geführt, und es wäre unnütze Zeitvergeudung, durch Spekulation die exakten Forschungen ersetzen zu wollen. Ob man einmal dahin kommen wird, den Sitz solcher Centren und so auch den Sitz des absoluten Tonbewußtseins im Gehirn feststellen zu können, ist zweifelhaft, aber keineswegs a priori abzulehnen.
Obwohl wir also noch wenig Vorstellungen von den Hirn-Centren haben, so operieren wir doch psychologisch mit ihnen. So trägt es wesentlich zum Verständnis des psychologischen Ganges des absoluten Tonbewußtseins bei, wenn wir uns schematisch die Verhältnisse zeichnen, die nach Analogie mit den anderen Sinnen etwa vorliegen müssen.
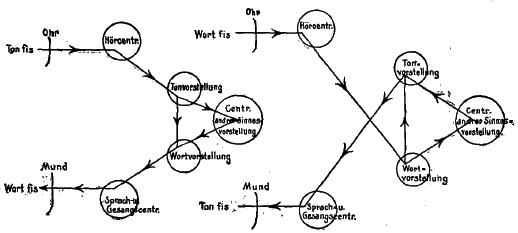
Nach diesen Darlegungen sind wir jetzt wohl im stande, eine kritische Sichtung der für das absolute Tonbewußtsein gebräuchlichen Bezeichnungen vorzunehmen. Wie ich durch meinen Fragebogen erfuhr, sind die Bezeichnungen: absolutes Tonbewußtsein, absolutes Tongedächtnis, absolutes Gehör, Tonsinn, absolutes Tongefühl, Tongefühl, Gehör, musikalisches Gehör, Tongehör und andere Bezeichnungen für dieselbe Fähigkeit im Umlauf.
Die ganz allgemein gehaltenen Ausdrücke Gehör, Tongehör, musikalisches Gehör sind für unsere spezielle Fähigkeit jedenfalls abzulehnen, eben so wenig kann man für sie die Bezeichnung Tonsinn anwenden. Tonsinn ist die psychische Funktion unseres Gehör-Apparates in seiner Gesamtheit und enthält sowohl Empfindung wie Gedächtnis und Gefühl für alle Ton-Qualitäten, unsere Fähigkeit ist also nur ein kleiner Theil desselben.
Jeden Ton begleitet ein eigenes Gefühl[34]. Je nach seinen Qualitäten kann ein Ton als angenehm oder unangenehm erklärt werden, die höchsten Töne sind sogar von einer Schmerz-Empfindung, also einem sehr unangenehmen Gefühl begleitet. Wenn wir nun lediglich das Gefühl des Angenehmen oder Unangenehmen unter Gefühl verstehen, dann ist es unmöglich, daß die Skala des Gefühls bei selbst hervorragend musikalischen Personen eine so feine Unterschieds-Empfindlichkeit aufweist, daß aus ihr der Name des Tones hergeleitet werden könne[35]. Viel mehr als die Höhe des Tones ist ja auch die Stärke und vor allem die Klangfarbe für das Gefühl des Angenehmen maßgebend; ob ein mildes c angenehmer klingt als ein ebenso mildes g, vermag ich ebenso wenig zu sagen als alle von mir interpellierten Beobachter, ich glaube auch nicht, daß es überhaupt möglich ist. Wenn wir also unter Gefühl das Gefühl des Angenehmen verstehen, ist der Ausdruck Tongefühl oder absolutes Tongefühl für unsere absolutes Tonbewußtsein genannte Fähigkeit zu verwerfen.
Es wurde aber oben gelegentlich der Charakteristik der Tonarten auch in einem anderen Sinne von Tongefühl gesprochen. Eben so wie As-dur ein anderes Gefühl hervorruft als C-dur, gleichgiltig, ob es aus konventionellen oder physikalischen Ursachen entstanden, so kann sich auch der Gefühls-Charakter der Tonart auf die Tonika desselben übertragen; diese Gefühle sind qualitativ verschieden und nicht in die Rubriken Angenehm und Unangenehm zu rangieren. Welcher Art diese Gefühle aber sind, ist begrifflich gar nicht zu erklären, es sind eben Gefühle, welche den Ton erst zum Individuum machen für jemanden, der Sinn dafür hat. Die Gefühle mögen durch komplizierte Associations-Bahnen entstanden sein, die nicht mehr nachzuweisen sind; wir besprachen aber schon die Möglichkeit, daß dieses Tongefühl für die Entstehung des sogenannten absoluten Tonbewußtseins von Wert ist. Aber selbst, wenn dies nachgewiesen würde, ja selbst als die Hegel für die Entstehung unserer Fähigkeit erkannt würde (was ich nicht glaube), so dürfen wir doch nicht diese mit dem Gefühl, welches zu ihrer Entstehung führt, identifizieren. Da wir mit absolutem Tonbewußtsein die Fähigkeit bezeichneten, die Association zwischen Wortbild und Tonbild zu vollführen, ist der Ausdruck absolutes Tongefühl also unter allen Umständen unzweckmäßig und unlogisch.
J. v. Kries hat in seiner mehrfach zitierten Arbeit unsere Fähigkeit absolutes Gehör genannt. Wenn man weiß, was man sich unter absolutem Gehör vorzustellen hat, dann erscheint der Name, schon seiner Kürze wegen, recht passend; daß er keine Definition in sich birgt und zu weit und unklar gefaßt ist, hat auch v. Kries erkannt und den Namen nur der Kürze und des weit verbreiteteten Gebrauchs wegen angewandt.
Ebenso habe ich bisher immer von absolutem Tonbewußtsein gesprochen, weil der Ausdruck nach meiner Enquete am häufigsten für die in Frage kommende Thätigkeit benutzt wird; doch habe ich schon seine Unzulänglichkeit besprochen. Das Bewußtsein ist ja auch zu verschieden definiert worden, und Einigkeit ist noch nicht erzielt worden[36]. Versteht man unter Bewußtsein psychische Versuche überhaupt, dann fällt zwar unser absolutes Tonbewußtsein in seinen Bereich, aber dann ist die Bezeichnung Bewußtsein wieder zu allgemein. Bezeichnet man aber mit Bewußtsein nur die Eigenschaft psychischer Zustände, neben ihrem direkten Inhalt (Ton) auch sich selbst zum Inhalt zu haben, dann ist einerseits der Name Ton zu allgemein (man müßte Tonhöhe sagen), andererseits aber der Ausdruck Bewußtsein zu speziell, denn dann würde die Fähigkeit, gehörte Töne richtig zu benennen, nicht dazu gehören, weil bei dieser, wie wir sahen, eine central erregbare Ton-Vorstellung unnötig ist. Absolutes Tonbewußtsein könnten wir also allenfalls nur die Fähigkeit nennen, sich eine beliebige Tonhöhe frei vorzustellen, trotzdem dann immer noch das Mißverhältnis bestehen bleibt, daß eine Fähigkeit Bewußtsein genannt wird.
Alle diese Schwierigkeiten fallen aber fort, wenn wir einen Begriff nehmen, unter welchen sowohl Wiedererkennung wie Association und bewußte Vorstellung fallen, und das ist das Gedächtnis. Wir brauchen dann die verschiedenen Arten der Fähigkeit nicht speziell zu bezeichnen, sondern können sie, glaube ich, logisch und psychologisch zusammenfassen unter der Bezeichnung: Gedächtnis für absolute Tonhöhen. Wohl ist auch dieser Ausdruck zu allgemein, denn ein gewisses Gedächtnis für absolute Tonhöhen hat für minimale Zeiten jeder, auch ohne unsere Fähigkeit zu besitzen. Man müßte die Dauerhaftigkeit des Gedächtnisses noch in dem Begriff zum Ausdruck bringen; doch die Dauer des absoluten Tonbewußtseins ist ja bei Mangel an musikalischer Übung auch wieder nur temporär. Ich glaube, man nimmt am besten doch die Bezeichnung Gedächtnis für absolute Tonhöhen oder kurz absolutes Tongedächtnis mit der stillschweigenden Voraussetzung, daß es noch ein unmittelbares Wiedererkennen von Tonhöhen giebt, das jeder Mensch sein eigen nennt, und das nichts mit der beschriebenen Fähigkeit zu thun hat.
Wie über das meiste, was das absolute Tonbewußtsein betrifft, noch keine Klarheit und Einigkeit herrscht, so ist speziell die Frage viel erörtert worden und doch noch nicht entschieden, ob das absolute Tonbewußtsein ein notwendiger Bestandteil eines gemeinhin als musikalisch zu bezeichnenden Kopfes zu betrachten sei. Die meisten Musiker, speziell diejenigen, welche kein absolutes Tonbewußtsein besitzen, hegen die Ansicht, daß dies für die musikalische Praxis unnötig sei, und daß überhaupt das Bestehen eines absoluten Gehörs keineswegs ein Kriterium für hervorragende musikalische Eigenschaften sei. Eine gänzlich andere Ansicht vertritt Stumpf[37] in seiner »Tonpsychologie«, die ich hier wörtlich citieren möchte:
Die meisten Personen, die als gut musikalisch gelten und wirklich Gehör und Urteil über die Gediegenheit einer Komposition besitzen, sind nicht fähig, die absolute Höhe eines beliebigen Tones mit erheblicher Zuverlässigkeit zu bestimmen, wenn derselbe isoliert am Klavier angegeben wird. Musikalische Begabung hervorragenden Ranges, durchdringendes Verständnis und vollster Genuß größerer musikalischer Werke setzen dagegen allerdings diese Fähigkeit voraus. Sie unterstützt wesentlich das Heraushören eines relativ schwachen Tones in einer Tonmasse, Sicherheit des Treffens beim Singen, die Erkenntnis der Richtung und Einheit der Modulation. In letzterer Hinsicht bildet zwar für den Ausführenden der Anblick der Noten eine Art Surrogat, und es liegt darin gewiß einer der wichtigsten Vorteile des Selbstspielens oder des Notenlesens für alle diejenigen, welche durch das bloße Ohr die absolute Tonhöhe nicht sicher erkennen. Auch bringt der Verlauf eines Stückes, wenn die absolute Tonika vergessen worden ist, dieselbe unter Umständen durch Vermittlung besonderer Anhaltspunkte, wie der Klangfarbe leerer Saiten bei Streichinstrumenten in Erinnerung: Aber das vollkommene musikalische Gehör darf darauf nicht angewiesen sein. Ihm muß von Anfang bis zum Ende längerer Stücke die absolute Höhe der Tonika, die sogenannte Tonart des Stückes gegenwärtig bleiben.
Ich möchte mich Stumpf hierin völlig anschließen. Es ist ja möglich, daß ein gut ausgebildeter Intervall-Sinn das absolute Tonbewußtsein in vieler Hinsicht ersetzen kann. So z. B. giebt es Sänger, die nur nach Intervallen urteilen und doch ein Gesangsstück prima vista heruntersingen können, doch sind das Ausnahmefälle. Viel schwieriger aber gestaltet sich das Festhalten der Tonart beim Hören mehrstimmiger Musik. Ein mir bekannter, hervorragend musikalischer Sänger versuchte auf meine Anregung an einem Quartett-Abend von Joachim und Genossen die Tonart zu fixieren und in ihren Modulationen zu verfolgen, und wirklich gelang es ihm, obwohl er keine Spur von absolutem Tonbewußtsein besitzt, bei einem Haydn'schen Quartett in allen 4 Sätzen bei gespannter Aufmerksamkeit alle Modulationen richtig zu beurteilen und zum Schluß der Sätze zu seiner Freude die Anfangstonart wieder zu erkennen. Bei einem darauffolgenden Quartett von Brahms jedoch mußte er schon nach 8-10 Takten die Flinte ins Korn werfen, und er behauptete, daß es ihm auch in dem Haydn'schen Quartett eine furchtbare Anstrengung gewesen sei, und daß er über dem Experimentieren jeden Gefühlsgenuß der Musik entbehrt habe. Der Genuß in der Musik besteht ja nicht im Analysieren von Harmonien, sondern vor allem in der elementaren Wirkung von Tonmassen und Tonfolgen, in der Erkennung der Themata und ihrer Durchführung u. s. w. Sowohl den elementaren Gefühlsgenuß wie auch die letztere mehr wissenschaftliche Befriedigung[38] kann derjenige nicht haben, der krampfhaft auf Tonika und Dominante achtet. Das ist also der bedeutende Nutzen des absoluten Tonbewußtseins, daß man alle musikalischen Schönheiten in sich aufnehmen und sich doch in jedem Augenblick die Tonart vergegenwärtigen kann, wenn es sich darum handelt, die Tonart eines neuen Themas zu fixieren oder zu bestimmen, in welchem Teile der Durchführung man sich befindet.
Also ersetzen läßt sich für den musikalischen Gebrauch das absolute Tonbewußtsein selbst nicht durch das vollkommenste Intervall-Gedächtnis. Viele Musiker helfen sich damit, immer eine Stimmgabel in der Tasche zu tragen und sich mit Hilfe derselben den jeweiligen Stand der Tonart zu suchen. Da das Mittel aber nicht gut im Konzert anzuwenden ist, und da besonders durch das Anschlagen der Gabel (Anblasen des Pfeifchens) und die Intervall-Vergleichung des a mit dem zu untersuchenden Ton so viel Zeit verloren geht, daß die nächsten Akkorde und Takte ganz der Aufmerksamkeit entgehen, so ist dies wohl ein wertvolles Hilfsmittel für die Tonhöhen-Erkennung, aber keinesfalls ein Ersatz für das absolute Tonbewußtsein.
Der Wert des absoluten Tonbewußtseins ist aber noch deutlicher zu erkennen in der produktiven Musik. Ich glaube nicht, daß es für die Reinheit im Instrumentalspielen in Betracht kommt, von großer Wichtigkeit aber ist es für den Gesang. Für den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Sänger giebt es nur gesangstechnische Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit, die andere Sänger bei ungewohnten Tonfolgen empfinden, besteht für ihn nicht. Für ihn ist es gleich, f-a oder f-cis hinter einander zu singen, denn er singt weder eine Terz noch eine übermäßige Quinte, sondern die absoluten Tonhöhen f a cis. Der harmonische Zusammenklang ist ihm für die Treffsicherheit völlig gleichgiltig.
Auch der Komponist kann meiner Ansicht nach das absolute Tonbewußtsein nicht entbehren. Durch Konvention und andere Ursachen, die ich des Näheren oben angegeben habe, hat jede Tonart etwas Charakteristisches; und so mancher Komponist würde schwer beleidigt sein, wenn er das in neuerer Zeit übliche oft unsinnige Transponieren seines Werkes mit anhören müßte. Das Charakteristische der Tonart, hat also der Komponist während des Komponierens bewußt oder unbewußt im Sinne, und da die Charakteristik der Tonart ohne absolutes Tonbewußtsein, wie wir sahen, nicht zur Feststellung der Tonart genügt, so muß der Komponist absolutes Tonbewußtsein haben, wenn er nicht, was bei den meisten verpönt ist, am Klavier komponieren will oder sich wieder des mangelhaften Ersatzes der Stimmgabel-Prüfung bedienen will. Wenn also auch nicht unbedingtes Erfordernis, so ist doch das absolute Tonbewußtsein dem Komponisten fast unentbehrlich. Ausnahmen sind allerdings bekannt; so wird von Meyerbeer berichtet, daß er stets ein Stimmpfeifchen bei sich trug, um sich der Höhe seiner Vorstellungstöne zu vergewissern.
Die Komponisten, welche ein absolutes Tonbewußtsein haben, unterscheiden sich aber auch von denen, die nur ein Intervall-Gedächtnis haben, noch in anderer Beziehung: das Komponieren ist eine Thätigkeit der Phantasie, die bekanntlich darin besteht, daß Gedächtnisbilder in anderer Anordnung, als sie aufgenommen sind, an einander gereiht werden (im Gegensatz zur Erinnerung, bei welcher die Reihenfolge der Gedächtnisbilder erhalten bleibt). Je kleiner die Gedächtnis-Komplexe sind, welche verschieden geordnet werden sollen, um so origineller ist der Komponist. Derjenige, der mehrere Takte hinter einander eben so komponiert, wie ein früherer bekannter Tondichter, macht sich wissentlich oder unwissentlich des Plagiates schuldig. Manche Phrasen werden allerdings von den meisten verwendet, doch darf die Länge derselben nur gering sein, aber ganz ohne Wiederholung kann man in der Komposition schon deshalb nicht auskommen, weil die Anordnung der Gedächtnisbilder sich nur in den Grenzen vollzieht, welche die Theorie der Musik (Rhythmik, Harmonielehre u. s. w.) vorschreibt. Wenn diese aber innegehalten werden, dann würde similia similibus derjenige der originellste Komponist sein, welcher die kleinsten Gedächtnisbilder vermischt; das kleinste Gedächtnisbild ist aber in der Musik für den nur mit Intervall-Gedächtnis begabten Komponisten das Intervall, für den nach absoluten Höhen urteilenden Musiker der einzelne Ton. Da nun zu einem Intervall stets zwei Töne gehören, so sind für den nach Intervallen Urteilenden, wenigstens in der Harmonie, engere Grenzen gezogen als für den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker, der frei schalten kann über alle Harmonien, allein gehalten durch die konventionellen Gesetze der Theorie, die für alle gelten. Mithin wäre letzterer der originellere Komponist. Ob diese Überlegung nicht nur theoretisches Interesse hat, sondern auch praktisch von Wichtigkeit ist, müßte eine Prüfung der Komposition und des absoluten Gehörs der bekannteren Komponisten ergeben.
Jedenfalls ist es klar, daß das absolute Tonbewußtsein sowohl für ein eindringendes Verständnis und schnelles Erfassen von Musik-Schönheiten, wie für den reproduzierenden und komponierenden Musiker eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Es ist aber auch denkbar, daß ein absolutes Tonbewußtsein bestehen kann, ohne daß sonst irgend welche nennenswerten musikalischen Eigenschaften vorhanden sind; das wird vielfach behauptet, meistens allerdings von Musikern, die kein absolutes Tonbewußtsein besitzen, aus Gründen vielleicht, die in einem außermusikalischen Gedankenkreis zu suchen sind.
Als Maßstab einer hervorragenden musikalischen Begabung rechne ich die Phantasie. Diese braucht sich nicht in kunstgerechten Kompositionen zu dokumentieren, auch das sogenannte Phantasieren am Klavier gehört hierher; ja die Fähigkeit, zu vorgelegten Themen sofort die richtige Modulation zu finden, ist ein Zeichen des produktiven Talentes. Da haben mir nun meine Fragebogen einen überaus wertvollen Aufschluß gegeben über die Beziehung des absoluten Tonbewußtseins zur musikalischen Produktivität. Alle Beantworter meines Fragebogens mit Ausschluß derer, welche nur einen Ton durch mittelbare Kriterien finden, alle, an Zahl 87, haben angegeben, produktiv thätig zu sein, besonders gern frei zu phantasieren. Die Frage, ob sie im stande wären, zu bekannten Melodien die richtigen Bässe zu spielen, haben viele entrüstet als selbstverständlich bejaht. Diese regelmäßige Beantwortung meiner diesbezüglichen Fragen ist so auffallend, daß das Zusammenbestehen des absoluten Tonbewußtseins mit musikalischer Produktivität mehr als koordiniert erscheinen muß. Ich glaube, daß dabei ein Kausalnexus vorliegt, ohne bisher im stande zu sein anzugeben, weiches die Ursache, welches die Folge ist. Es ist ebenso möglich, daß das absolute Tonbewußtsein, wie oben besprochen, da es ganz frei mit den Gedächtnisbildern schalten kann, für produktive Thätigkeit prädisponiert. Andererseits kann es sehr wohl sein, daß durch musikalische Phantasie-Thätigkeit die Aufmerksamkeit besonders den Tonhöhen zugewendet wird, und daraus ein Tonbewußtsein resultiert. Für die letztere Auffassung könnte allenfalls sprechen, daß zwar alle mit absolutem Tonbewußtsein Begabten auch produktiv begabt sind, daß aber nicht alle produktiv Begabten ein absolutes Tonbewußtsein besitzen.
Das jedenfalls scheint nach meiner Statistik festzustehen, daß, wenn man das Produktions-Talent als Maßstab einer hervorragenden musikalischen Begabung ansieht, und wenn ein absolutes Tonbewußtsein mit diesem gepaart ist, doch das absolute Tonbewußtsein als Zeichen oder als Prognostikon eines hervorragend musikalischen Talentes zu betrachten ist.
Von großem Interesse ist es, die Beziehungen des absoluten Tonbewußtseins auch zu anderen musikalischen Eigenschaften zu untersuchen. Da kommt zunächst der Intervall-Sinn in Frage, der von mir schon wiederholentlich berührt worden ist. Wir sahen, daß absolutes Tonbewußtsein und Intervall-Sinn völlig von einander zu trennen sind, und daß die nur mit Intervall-Sinn begabten Musiker sich von denen, die ein absolutes Tonbewußtsein besitzen, wesentlich unterscheiden; aber wir müssen noch betrachten, wie sich der Intervall-Sinn bei einem mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker verhält. Kann dieser ein Musikstück verschiedentlich auffassen, einmal nur nach absoluten Höhen urteilend, ein andermal nur nach Intervallen, und welches ist die vorherrschende Auffassung?
Im Allgemeinen zeigt sich, daß auch bei Musikern, die ein absolutes Tonbewußtsein besitzen, doch meist das Intervall-Bewußtsein noch stärker ausgeprägt ist, als jenes. Aber es kommen auch Fälle vor, bei denen der Intervall-Sinn verschwindend klein ist gegen das absolute Gehör. Einen Beweis kann man in Folgendem finden. Viele mit absolutem Tonbewußtsein begabte Musiker empfinden eine große Schwierigkeit, wenn sie ein Lied singen, das vom Begleiter in eine andere Tonart, als die Gesangsnoten zeigen, transponiert wird. Nehmen wir an, ein Sänger habe von Noten c e a zu singen; der Begleiter transponiert aus irgend welchem Grunde die Begleitung um einen Ton höher, unser Sänger müßte also jetzt statt c e a die Töne d fis h singen. Die Notenbilder c e a sind bei ihm aber fest mit den Klängen c e a associiert, er muß also jetzt willkürlich und bewußt selbst im Geiste transponieren. Wenn nun ein Gesangsstück in schneller Taktart geschrieben ist, dann hat der Sänger keine Zeit, bei jeder Note sich im Geiste zu überlegen, wie die nächste Note transponiert lauten würde, er würde also trotz seines guten Gehörs oder gerade wegen seines guten Tonbewußtseins falsch singen. Ich kann dabei aus eigener Erfahrung mitsprechen; ich bin Mitglied in dem hiesigen Schnöpf'schen Gesangverein, dessen Dirigent, Prof. Schnöpf, häufig ein Chorstück aus gesangstechnischen Gründen einen halben bis ganzen Ton höher oder tiefer singen läßt, als es auf den Noten steht. Während nun alle anderen Sänger ohne Schwierigkeit ihr Lied heruntersingen, sie wissen ja gar nicht, daß es transponiert ist, sie singen nach Intervallen -- ist es für mich eine wahre Qual mitzusingen. Während ich in der richtigen Tonart nie einen Fehler mache, entgleise ich beim Transponieren ein über das andere Mal. Jede einzelne Note muß ich mir im Geist transponieren, und dazu fehlt oft die Zeit.
Einen interessanten Unterschied aber macht oft die Distanz, um welche transponiert wird; um einen Ganzton und darüber muß ich stets willkürlich mittransponieren. Handelt es sich aber um einen Halbton, dann transponiere ich wohl im Anfang des Stückes, bin aber nach einigen Takten im stände, mir einzureden, es wäre die richtige Tonart, d. h. ich verstimme willkürlich mein Tonbewußtsein um einen halben Ton, ich bilde neue Associationen zwischen Notenbild und Tonbild. Hierbei kommen wahrscheinlich zwei Umstände als begünstigend in Betracht. Einmal hören wir in der praktischen Musik vielerlei Stimmungen; wir haben zwar ein Normal-a = 435 Schwingungen, doch erstens weichen schon erheblich viele Stimmgabeln von dieser Norm ab, zweitens wird meistens, wenn überhaupt, nach einer Stimmgabel unrein gestimmt. So kommt es, daß wir Klavier- und Orchester-Vorführungen hören, die bis fast 1/3 Ton von einander abweichen. Dadurch wird der Tonbegriff des mit absolutem Tonbewußtsein begabten, viel Musik hörenden Musikers ein etwas weiterer, dehnbarerer.
Der zweite Faktor, der aber noch hinzukommt, ist der Wille. Stumpf hat in seiner Tonpsychologie I, 244 geschrieben, daß, wenn er eine schwingende Stimmgabel vor dem Ohre dreht, wobei große und geringe Stärke mit einander abwechseln, es ihm möglich ist, willkürlich die Schwächung als Erhöhung oder Erniedrigung aufzufassen. Wie dies psychologisch zu erklären ist, bleibt allerdings zweifelhaft, aber für unsere Frage kommt der Wille sicherlich in Betracht; denn es ist nicht möglich, daß die willkürliche Verstimmung durch die Dehnbarkeit des Tonbegriffs allein erklärt, zumal, wie ich oben zeigte, mein Tonbegriff ein viel präziserer ist. Ein halber Ton ist allerdings die äußerste Grenze, um die ich mein Ton-Erinnerungsbild herauf- oder herunterschrauben kann, und würde ich nicht durch den übrigen Chor oder die Begleitung in der Tonart gehalten gezwungen, in den neuen Associationen zu bleiben, so würde ich allmählich in die Tonart, die in den Noten steht, zurückgleiten. Ich habe ein diesbezügliches Experiment einmal unter recht unliebsamen Umständen angestellt: ich sang in einer kleinen Aufführung mit drei Herren zusammen ein Gesangsquartett ohne Instrumentalbegleitung. Wir fingen alle vier richtig in B-dur an, die anderen drei rückten aber von Vers zu Vers herunter bis A-dur, ich dagegen konnte ihnen dabei nicht folgen und sang mein B-dur immer weiter; es soll eine Musik gewesen sein, die Stein' erweichen, Menschen rasend machen kann. Stumpf[39] berichtet von einem Knaben Ahnliches.
Als derselbe als Sängerknabe in die Hofkapelle kam, war dort die Stimmung höher oder tiefer als zu Hause; er aber sang unbekümmert in der Stimmung des heimatlichen Klaviers entsetzlich falsch fort, er mußte sich dann längere Zeit jeden Ton transponieren, um rein singen zu können.
In der allgemeinen Musikzeitung[40] berichtet O. Leßmann Folgendes:
Domenico Mustafa, Direktor der Sixtinischen Kapelle, hatte ein unglaublich feines Gehör, was ihm natürlich bei seiner Ausbildung sehr zu statten kam. Jeder Ton der Skala stand bei ihm fest im Gedächtnis. Eine leise Schwingung tiefer oder höher als die Normalstimmung der Sixtinischen Kapelle wußte er genau zu unterscheiden, sie berührte ihn unangenehm; er sang stets nach Tönen, nie nach Intervallen, sozusagen phonetisch, nicht diatonisch, weshalb, wenn er ein Notenbild vor sich hatte und transponieren sollte, ihm dies immer Unbequemlichkeiten machte.
Beim Klavier und ähnlichen Instrumenten wirkt das Transponieren für das absolute Tonbewußtsein nicht so störend, wie beim Gesang und Streichinstrumenten, wenngleich auch hierbei das Ohr sich erst an die fremde Stimme gewöhnen muß. Ein Fräulein P. C. machte mir darüber eine recht genaue Mitteilung:
Einer meiner Brüder hat ein Klavier-Geschäft, wo viele Klaviere sind, die vollständig verschieden sind in der Tonhöhe, Klangfarbe etc. Wenn ich nun ein Lied von richtigen Noten in der richtigen Tonart auf einem um 1/2 Ton zu tief oder zu hoch stehenden Klaviere spiele, so stört mich das zuerst sehr, da ich die Noten, wie sie richtig klingen, im Ohre habe. Habe ich aber eine Weile gespielt, dann habe ich mich vollständig daran gewöhnt, sodaß ich anstatt in Edur in Fdur spiele und es als Fdur betrachten kann.
Also hierbei handelt es sich um ein Verstimmen des Gehörs, d. h. um eine Neubildung von Associationen. Diese gelingt nicht immer, wie schon oben angegeben ist, und ist auch individuell sehr variierend. So teilt mir Herr Prof. Rudorff mit, daß seine Mutter »als sie in ihrem Alter ein neues Pianino bekam, das im Vergleich zu der ihr gewohnten Stimmung bedeutend tiefer stand, den ersten Satz der cis-moll Sonate von Beethoven in d-moll spielte, weil es ihr Unbehagen verursachte, den Satz in c-moll, welches den gespielten cis-moll-Tasten entsprach, hören zu müssen. Eine Erklärung dieses Phänomen ist nicht leicht: Die betreffende Dame hat ein sehr stark entwickeltes absolutes Tonbewußtsein. Bei ihr ist der Begriff cis-moll in Wort, Notenbild und Tasten fest associiert mit den absoluten Tonhöhen in cis-moll. Weil es nun der Dame unangenehm ist, das gespielte cis-moll in der Tonvorstellung als c-moll zu hören, d. h. weil sie keine neuen Associationen zwischen den Tasten cis-moll und der Ton-Vorstellung c-moll bilden kann, spielt sie d-moll, um cis-moll zu hören. Da diese Associationen eben so wenig möglich sind, als zwischen cis- und c-moll, da es sich in beiden Fällen um eine gleiche Verstimmung handelt, muß man annehmen, daß zu dem Vorstellungsbegriff {cis-moll) noch etwas hinzukommen muß, das ihm das Übergewicht über die Empfindungs-Komplexe verleiht. Es ist wohl möglich, daß das Neue im Gefühl zu suchen ist, welches das ganze Tonstück in seiner Normalstimmung hervorruft. Die cis-moll-Sonate, dieses vollkommene Stimmungsbild, ruft bei der mit absolutem Tonbewußtsein begabten Dame ein Gefühl hervor, welches bei Transposition nicht erzielt wird. Sie vermag daher eher die Schwierigkeit der Technik bei der veränderten Tasten-Transposition nach d-moll zu überwinden, als den gestörten Gefühlseindruck.
Bei meiner Enquete über das absolute Tonbewußtsein stellte ich ebenfalls die Frage: Können Sie, wenn ein Lied vom Begleiter transponiert wird, dasselbe ohne Schwierigkeit singen, oder müssen Sie sich dasselbe erst ebenfalls im Geiste bewußt transponieren? Die Mehrzahl der Gefragten hatte keine bewußte Transposition nötig, bei ihnen war also anscheinend das Intervall-Bewußtsein stärker, als das absolute Tonbewußtsein, aber doch etwa ein Drittel der Beantworter war eben so geartet, wie die oben Geschilderten; auch sie mußten transponieren und empfanden mehr oder weniger Unannehmlichkeiten dabei.
Max Planck[41] erzählt von sich, daß er in früherer Zeit, als er auf einem Instrumente (Klavier) spielte, ein sehr starkes absolutes Tongefühl besaß. Als er einmal aufgefordert wurde, einen ihm sehr wohl im Gedächtnis bekannten Marsch auf einem fremden, etwas tiefer gestimmten Klavier zu spielen, mußte er nach den ersten Tönen abbrechen, weil er vollständig verwirrt wurde und nicht die Fertigkeit besaß, in der Eile die doppelte Transposition zu machen, einmal im Kopfe in eine tiefere Tonart und dann wieder auf den Tasten zurück in die frühere Tonart[42].
Es ist der Fall denkbar, daß ein Musiker, der ein absolutes Tonbewußtsein besitzt, überhaupt kein Intervall-Bewußtsein besitzt. Ich glaubte dies z. B. eine Zeit lang von mir selbst. Hörte ich ein Intervall a f, und soll ich das Intervall bestimmen, dann sage ich wohl richtig, daß ich eine Sexte gehört habe. Dieses Urteil ist aber bei mir kein ursprüngliches, sondern eine Schlußfolgerung. Im Geiste sage ich mir erst, die Noten waren a f, da ich nun weiß, daß man das Intervall a f eine Sexte nennt, so nenne ich es eine Sexte. Ich kann also ein richtiges Intervall-Urteil fällen, ohne eine Spur von Intervall-Gedächtnis zu besitzen. Entwicklungsgeschichtlich scheint es, als ob das bestehende absolute Tonbewüßtsein die Entwicklung des Intervall-Sinns in ähnlicher Weise verhindert, wie bei dem Gros der musizierenden Menschen die Entwicklung und Pflege des Intervall-Sinnes ein richtiges absolutes Tonbewußtsein nicht aufkommen läßt. In der weitaus größten Zahl der Fälle beurteile ich auch so die Intervalle; erst in diesem Jahre bin ich mir klar geworden, daß ich jedoch kleinere Intervalle, Sekunde, Terz mindestens auch mit dem Intervall-Sinn erkenne. Herr Prof. Stumpf ließ mehrere Beobachtungs-Reihen anstellen, wie die Intervalle bei verkürzter Klangdauer beurteilt würden; die Versuchs-Personen schrieben das Gehörte als Intervall nieder und in eine spezielle Rubrik die absoluten Tonhöhen, auf welche es aber weniger ankam. Ich weiß nun bestimmt, daß ich jedes große Intervall, von der Quarte schon an, erst aus den absoluten Tonhöhen erschlossen habe, die kleineren Intervalle lösten dagegen häufig in mir das Intervallurteil aus, ohne daß ich mich der psychischen Thätigkeit eines Schlusses bewußt wurde. Das Urteil Terz sprang hervor, ohne daß ich die absoluten Tonhöhen wußte. Ich mußte allerdings die Aufmerksamkeit ganz von den absoluten Höhen abwenden und mich mehr dem Gefühlseindruck des Intervalls hingeben.
Von weiteren Gebieten des musikalischen Könnens, die in ihrer Beziehung zum absoluten Tonbewußtsein zu untersuchen sind, ist besonders das musikalische Gedächtnis von Wichtigkeit; dasselbe zerfällt in ein rhythmisches, ein Harmonie- und ein Melodie-Gedächtnis. Wollte man Genaueres über das rhythmische Gedächtnis von Musikern, die ein absolutes Tonbewußtsein besitzen, aussagen, so müßte man lange Versuchs-Reihen anstellen und sie vergleichen mit den Resultaten, die man über das rhythmische Gedächtnis anders gearteter Musiker erhält. Das wäre eine überaus mühselige Arbeit, die sich wahrscheinlich gar nicht lohnte, denn a priori ist es gar nicht einzusehen, daß überhaupt ein Zusammenhang zwischen rhythmischem Gedächtnis und Tongedächtnis bestehen müßte. Ich möchte dies zwar nicht verneinen, sondern lasse die Frage unbeantwortet.
Der Beobachtung zugängiger ist dagegen das Melodie-Gedächtnis, schon deshalb, weil jeder Musikliebende auf sein Melodie-Gedächtnis mehr achtet, als auf jede andere musikalische Fähigkeit. Deshalb kann er es auch mit dem Melodie-Gedächtnis anderer vergleichen und ein Urteil abgeben, ob es gut oder schlecht ist. Zwar sind die Begriffe gut und schlecht sehr dehnbar und gehen in einander über, nur ihre Grenzen, sehr gut und sehr schlecht, sind deshalb für wissenschaftliche Resultate allenfalls verwendbar. Es hat sich nun bei meiner Enquete gezeigt, daß gerade die Individuen, welche ein sehr starkes absolutes Tonbewußtsein besitzen, ein überaus mangelhaftes Melodien-Gedächtnis haben. Sehr starkes absolutes Tonbewußtsein nenne ich ein absolutes Tonbewußtsein, welches stärker ist als der Intervall-Sinn, und welches in beiden Associations-Richtungen funktioniert. Die Besitzer gerade dieses absoluten Tonbewußtseins klagen ausdrücklich darüber, daß sie im Melodien-Behalten vielen, sonst weit weniger Musikalischen, nachstünden.
Man muß hier unterscheiden zwischen einem schnell erfassenden und einem gut aufbewahrenden Melodie-Gedächtnis. Das erstere ist bei den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Menschen besonders mangelhaft entwickelt. Wenn aber die Melodie erst einmal im Gedächtnis haftet, dann ist sie noch lange Zeit nachher reproduzierbar. Viele dieser Musiker helfen sich, um das Gedächtnis für Melodien zu verbessern, damit, daß sie sich die Anfangsnoten des Stückes in Buchstaben merken, sie sind ja durch ihr absolutes Tonbewußtsein dazu im stände. Ich selbst merke mir die wichtigen Themata ebenfalls in Buchstaben und suche mir, da ich bei meinem überhaupt schlechten Gedächtnis auch diese Buchstaben vergessen würde, dieselben in Worten zu behalten, so z. B. die Tonfolge a, f, f, e im Wort Affe, die Noten b, a, b, e in Barbier u. s. w. Dieselben Hilfsmittel wenden auch andere an, wie ich durch meinen Fragebogen erfahren habe; wieder andere denken sich beim Hören einer Melodie die dazu gehörigen Notenbilder, Tastenbilder oder Griffe der Hand auf Klavier oder Geige, d. h. sie gebrauchen etwa dieselben bewußten mittelbaren Kriterien zur Unterstützung des Gedächtnisses, wie wir sie oben bei der Ton-Reproduktion kennen gelernt haben.
Auffallend erscheint es doch, daß Menschen, die ein Gedächtnis für absolute Tonhöhen haben, welches kaum an die Zeit gebunden zu sein scheint, zum großen Teil ein so mangelhaftes Gedächtnis für Tonfolgen (Melodien) zeigen. Es läßt dies einen Schluß darauf ziehen, daß Melodie-Gedächtnis und absolutes Ton-Gedächtnis entweder verschiedene, von einander entfernte Centren im Gehirn haben müssen, oder daß bei den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Menschen die Bahnung der Associationen von Ton zu Ton schwieriger zu stände kommt, als von Ton zu anderen Bewußtseins-Inhalten: Wort, optisches Bild u. s. w. Und so haben gerade diejenigen, die das stärkste absolute Ton-Gedächtnis haben, bei denen es stärker ist, als der Intervall-Sinn, am wenigsten Melodie-Gedächtnis. Ist das absolute Tonbewußtsein und Intervall-Sinn gleich gut entwickelt, oder überwiegt das Intervall - Gedächtnis, dann finden wir auch ein besseres Melodie-Gedächtnis; mein Fragebogen beweist dies durchweg. Man muß daher annehmen, daß Mozart, der neben «einem scharfen absoluten Gehör auch ein phänomenales Melodie-Gedächtnis gehabt haben soll, zu der letzten Kategorie gehört hat, daß nämlich sein Intervall-Gedächtnis noch stärker war als sein absolutes Tonbewußtsein. Ich will natürlich nicht behaupten, daß die Art des Melodie-Behaltens, die ich für die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker beschrieben habe, etwa die Regel ist, daß etwa die Melodien von diesen meist so behalten werden, daß die Buchstaben der Noten im Gedächtnis aufbewahrt werden und aus ihnen wieder die Reproduktion der Noten von statten geht. Genau zu analysieren, wie eine Melodie im Gedächtnis fixiert wird, ist gewiß eine sehr schwierige, wenn nicht unmögliche Aufgabe. Aber sicherlich giebt es dabei zwei Hauptarten; die Melodie besteht aus einzelnen Tönen oder aus Intervallen, und so kann sich auch das Melodie-Gedächtnis zusammensetzen aus dem Gedächtnis für die einzelnen Töne (absolutes Tonbewußtsein) und dem Intervall-Gedächtnis. Die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Individuen brauchen nun nicht ausschließlich ihre Melodien rein durch Gedächtnis für die einzelnen Töne zu behalten. Das Gegenteil scheint oft der Fall zu sein. Jeder einzelne kann ein Volkslied singen, in welcher Tonart es immer verlangt wird, und dies würde auf Intervall-Gedächtnis schließen lassen. Bei schwierigen Liedern dagegen habe ich an mir vielfach erprobt, daß ich sie in der richtigen Tonart wohl aus dem Kopf singen konnte, aber nicht in einer anderen Tonart. Besonders auffallend war mir dies bei der Ballade »Edward« von Löwe. Ich konnte sie in der Normaltonart von Anfang bis Ende singen; nahm ich aber eine andere Tonart, dann kam ich entweder überhaupt nicht weit, d. h. ich wußte nach wenigen Takten nicht, wie die Melodie weiter ging, oder ich fiel von der ungewohnten in die alte Normal-Tonart zurück, in der ich die Ballade gewohnt bin zu singen. Speziell bei größeren Intervallen, Sexten, Septimen, machte ich diesen Fehler. -- Volkslieder kann ich zwar auch in allen Tonarten singen, doch liegt dies daran, daß ich sie einerseits oft in verschiedenen Tonarten gehört habe, andererseits, weil durch das häufige Hören auch Intervalle durch das allerdings schlechte Intervall-Gedächtnis schließlich doch festgehalten werden. Die Beobachtung, daß besonders große Intervalle durch absolutes Tonbewußtsein, nicht durch Intervall-Gedächtnis fixiert werden, stimmt sehr schön mit der oben mitgeteilten Beobachtung überein, daß bei den Versuchen, in denen Akkorde mit verkürzter Klangdauer zu Gehör gebracht wurden, die kleinen Intervalle scheinbar gleich den Intervall-Begriff (Terz) reproduzierten, die großen dagegen erst aus ihren absoluten Tonhöhen erschlossen wurden.
Da nun also die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker zum großen Teil die Melodien durch das Gedächtnis für die einzelnen Töne fixieren, und da scheinbar, je stärker das absolute Tonbewußtsein, um so schwächer das Melodien-Gedächtnis ist, so muß man annehmen, daß das Intervall-Gedächtnis weit wirksamer für das Behalten einer Melodie ist, als das absolute Ton-Gedächtnis. Die Hauptsache für das Behalten einer Melodie ist, die Anfangstöne im Gedächtnis zu behalten. Wie beim Lesen die ersten Buchstaben eines Wortes schon die nächsten Buchstabenbilder häufig reproduzieren, derart, daß von einem langen Wort nur die ersten Buchstaben gelesen und aufgefaßt werden, der Rest mehr erraten, d. h. als Erinnerungsbild reproduziert wird, eben so wie beim Auswendiglernen eines Gedichtes vor allem die Anfangsworte der Verse und? Strophen gekannt sein müssen, und wie die genaue Kenntnis derselben ein vorzügliches Mittel zur Reproduktion des ganzen Gedichtes ist, eben so zeigt sich auch in der Musik, daß das Gedächtnis für Melodien sich sehr auf die Auffassung und Fixierung des Anfanges der Melodie stützt, und daß durch ihn oft ein ganzes Tonwerk reproduziert wird. Wie oft passiert es einem Musiker, der nach irgend einer Melodie gefragt wird und absolut nicht im stande ist, sie zu reproduzieren, daß er sofort, sobald ihm die Anfangstöne angegeben werden, das ganze Stück vollkommen auswendig zu singen oder anderweitig zu reproduzieren vermag! In den ersten Tönen liegt ein Hinweis auf die nächsten; wie die Ringe einer Kette sind die Töne einer Melodie an einander gereiht, ein Zug an den einen" zieht die ganze Kette mit, wenn die Verbindungen stark genug sind, um ein Reißen der Kette zu verhindern. Ich habe absichtlich dieses Bild gewählt, weil es für das, was ich ausführen will, recht deutlich erscheint. Wir haben davon gesprochen, daß eine Melodie durch absolutes Tonbewußtsein und durch Intervall-Gedächtnis fixiert und reproduziert werden kann, das absolute Tonbewußtsein behält die Töne als Einzel-Individuen im Gedächtnis; das Intervall-Gedächtnis schließt die Beziehungen der Töne in sich ein; um also wieder im Bilde zu reden, das absolute Tonbewußtsein kennt nur einzelne Ringe, hinter einander aufgereiht, das Intervall-Gedächtnis verknüpft die Ringe zur Kette. Die Tonfolge a c f sind mit absolutem Tonbewußtsein aufgefaßt drei Töne, die mit einander nichts zu thun haben, mit Intervall-Sinn betrachtet sind es zwei Intervalle, kleine Terz und Quinte. Es sind also nicht mehr drei, sondern nur zwei Einheiten. Diese Einheiten unterscheiden sich aber noch sehr, in der Einheit a des nach absolutem Tonbewußtsein urteilenden Musikers liegt nirgends eine Beziehung zu c angedeutet, während die Einheit kleine Terz schon eine Beziehung darstellt. Bain, welcher eine Abhandlung geschrieben hat über die Art der Einprägung einer Melodie im Gedächtnis[43], drückt sich in ähnlicher Weise aus: »Die erste Note sagt nichts; drei oder vier sind nötig, den Gesang zu bestimmen«. Da es nun bei der Melodie-Reproduktion hauptsächlich auf die Anfangstöne ankommt, folgt hieraus, daß für diese das Intervall-Gedächtnis weit wirksamer sein muß, als das absolute Tonhöhen-Gedächtnis, was ja, wie erwähnt, auch durch die Thatsachen bestätigt wird.
Anders verhält es sich mit dem Harmonie-Gedächtnis. Um einen Akkord im Gedächtnis zu fixieren, ist es zunächst nötig, daß dieser in seinen Einzel-Bestandteilen erkannt ist. Man kann nicht fünf Akkordtöne reproduzieren, wenn man etwa nur drei herausgehört hat. Wir sahen nun oben, daß das absolute Tonbewußtsein für das Auffassen von Akkorden, für die Analyse, äußerst wertvoll ist. Der nach absoluten Höhen urteilende Musiker kann viel leichter ungewohnte Klänge analysieren, als der nach Intervallen urteilende. Auch Wallaschek sagt in seiner Abhandlung »Das musikalische Gedächtnis«[44], das relative Tonbewußtsein scheine die Auffassung der Melodie, das absolute Tonbewußtsein der Harmonie zu erleichtern. Wenn nun die dauerhafte Fixierung der Harmonien im Gedächtnis bei beiden gleich sein mag, so ist es klar, daß der Vorteil im Gesamtgedächtnis für Harmonien auf Seiten des mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musikers liegt, eben wegen der besseren Auffassungs-Fähigkeit. Beim Melodie-Gedächtnis kam diese nicht in Betracht, da Einzelklänge, die dem Ohr nach einander zugeführt werden, nicht analysiert zu werden brauchen und somit der Auffassung keine Schwierigkeiten bereiten.
Wir haben weiterhin oben gesehen, daß alle mit absolutem Tonbewußtsein begabten Menschen auch im stande sind, zu phantasieren, zu komponieren, oder mindestens sich zu vorgelegten Melodien eine den Anforderungen des Wohlklanges entsprechende Harmonie zu bilden. Diese Fähigkeit ist die Ursache, daß ein mit absolutem Tonbewußtsein begabter Musiker sich gleich zu jeder Melodie die nötigen Harmonien hinzu denkt; daher ist es sehr schwierig zu unterscheiden, wo bei ihm das Gedächtnis (Harmonie-Gedächtnis) aufhört, und wo die Phantasie anfängt. Entspricht der durch Phantasie vorgestellte Akkord dem früher gehörten, so ist ein Urteil über Harmonie-Gedächtnis ganz unmöglich. Weicht er von dem früher gehörten Akkord ab, so ist auch ein Schluß auf das Harmonie-Gedächtnis schwierig, man kann dann nur sagen, ob Gedächtnis oder Phantasie das stärkere ist. Da aber beides unbekannte Größen sind, so kann man sie einzeln aus der einen Gleichung nicht bestimmen. Im Übrigen aber kommen bei diesen Gedächtnis-Untersuchungen noch so komplizierte Dinge in Betracht, daß ich mich nicht vermessen will, mit meinen Ausführungen etwa das musikalische Gedächtnis analysiert zu haben; da kommt noch rhythmisches Gefühl, Gefühl für Harmonie und Verschmelzuing, Gedächtnis für Rhythmus u. s. w, in Betracht. Ich habe das musikalische Gedächtnis nur in Bezug auf das absolute Tonbewußtsein in Betracht gezogen, und da deckte sich das logisch Erschlossene mit den Thatsachen.
Wir haben in dem letzten Kapitel gesehen, daß das absolute Tonbewußtsein ganz bestimmte Beziehungen zu anderen musikalischen Eigenschaften hat, zweitens aber auch als ein sicheres Kriterium einer als musikalisch zu bezeichnenden Begabung aufzufassen ist. Das Wort »musikalisch« ist, obwohl es ungemein häufig angewandt wird, doch nicht in dem Maße definiert worden, daß es für die Wissenschaft der Psychologie eben so wie für die Umgangssprache genügte. Es liegt dies daran, daß mit dem Begriff »musikalisch« einerseits sehr viel zu umfassen ist, zweitens, daß fälschlich vieles unter dem Begriff subsumiert wird, was nicht dazu gehört, und drittens, daß meistens ungenügende Methoden gewählt wurden, um zur Klarheit zu gelangen.
Musikalisch alles zu nennen, was der Musik angehört oder dem Wesen derselben entspricht, eine Definition, die Schladebach-Befnsdorff in seinem Universallexikon der Tonkunst giebt, dürfte so manchen Widerspruch herausfordern. Sie dürfte vielleicht sprachphilologisch zu verteidigen sein, giebt aber vor allem für das, was wir im Menschen musikalisch nennen, keine Erklärung. Wir dürfen nicht das Wort musikalisch, sondern nur den Begriff »musikalische Begabung« zur Definition verwenden.
Häufig hört man den Begriff »musikalisch sein« identifizieren mit »musizieren können«. Jemand, der ein Instrument spielt, wird musikalisch genannt; danach müßte ein Künstler aufhören musikalisch zu sein, wenn er aus irgend welchen vielleicht technischen Gründen das Musizieren aufgiebt. Die musikalische Fähigkeit liegt aber natürlich nicht in den Händen, den Lippen oder dem Kehlkopf, sondern hat ihren Sitz allein im Gehirn und zwar nicht sowohl in dem Teile unseres Centralorganes, der die Bewegungen ausführen läßt, als in demjenigen, welcher die Empfindungen zum Bewußtsein kommen läßt, dieselben festhält (Gedächtnis) und sie in freier, nur durch einzelne konventionelle Gesetze beschränkter Reihenfolge (Phantasie) verarbeitet.
In den verschiedenen Musiklexicis sind Definitionen des musikalischen Gehörs versucht worden. Koch-Dommer (1865) bezeichnet mit musikalischem Gehör die Fähigkeit, Töne an sich und hinsichts ihrer Reinheit oder Unreinheit, also nicht nur ein Intervall von anderen, sondern auch noch so geringe Abweichungen eines oder des andern Intervalls von der Reinheit zu unterscheiden. Er identifiziert also musikalisches Gehör mit Reinheits-Urteil und Unterschieds-Empfindlichkeit.
In neuester Zeit ist von psychologischer Seite und zwar von M. Meyer eine Definition des Begriffs »Musikalisch« versucht worden[45]. Meyer definiert allerdings den Begriff »Unmusikalisch«, macht es aber leicht, durch Umkehrung auf seine Erklärungsart des »Musikalischen« zu schließen. Er sagt:
»Unter Unmusikalischen verstehen wir solche Personen, die bei beschränkter Klangdauer nur ausnahmsweise im stande sind zu analysieren, d. h. jeden einzelnen thatsächlich hörbaren Ton als wirklich gehört zu beurteilen. Wenn wir diesen Satz umkehren, müßten wir einen Menschen musikalisch nennen, welcher bei beschränkter Klangdauer fast immer im stände ist, jeden thatsächlich hörbaren Ton als gehört zu beurteilen; Gegen die Meyer'sche Definition wendet Stumpf[46] mit Recht ein, daß der Begriff beschränkte Klangdauer ein so vager ist, daß danach jeder Mensch für unmusikalisch erklärt werden könne, da von einer gewissen Klangverkürzung an jede Analyse aufhört. Nachdem Meyer daraufhin in einem Nachtrag zu seiner Abhandlung noch einige Zusätze zu seiner Definition gemacht hat, sagt er schließlich selbst, daß er keine allgemeine Definition des Begriffs Musikalisch beabsichtigt habe. Meyer's Erklärung würde sich auch nur auf einen, wenn auch bedeutenden Teil des musikalischen Gebiets beziehen, auf die Analyse der Harmonien.
Eine sehr sonderbare Erklärung des musikalischen Gehörs findet sich im Konversationslexikon der Musik von Mendel-Reißmann: »Musikalisches Gehör ist diejenige Fähigkeit unserer Seele, durch Gehörorgan, Nerven und Gehirn die Ideen, Gedanken, Empfindungen und Gefühle anderer zu vernehmen, sobald dieselben durch Tonempfindungen zur Darstellung gelangen. Das musikalische Gehör hat es also nicht mit der Wahrnehmung einzelner Gehörsempfindungen zu thun, sondern damit, solche Einzelwahrnehmungen zu einheitlichen Tonbildern zusammen zu fassen und die in diesen Bildern dargestellten seelischen Regungen des Komponisten auf unseren eigenen psychischen Mechanismus zu übertragen. Ausgeschlossen sind dann zunächst diejenigen Fertigkeiten, welche mehr auf dem Gedächtnis und der Erinnerung beruhen, als speziell musikalisch sind. Hierher gehört z. B. die Fertigkeit, absolute Tonhöhen, Intervalle und Akkorde nach bloßem Anhören genau bestimmen zu können, oder gehörte Ton- und Akkord-Verbindungen längere Zeit festzuhalten und aus dem Gedächtnis wiedergeben zu können. Diese Fertigkeit, die man der Regel nach als Tonsinn bezeichnet, sind zwar für den Musiker von großem Nutzen, es kann sie aber jemand in einem hohen Grade besitzen, ohne eigentlich musikalisch beanlagt zu sein, ohne also wirklich musikalisches Gehör zu besitzen. Ausgeschlossen ist ferner das sinnliche Vorstellungsvermögen, die Einbildungskraft oder die Phantasie im weitesten Sinne, d. h. die Fähigkeit, ohne sinnliche Eindrücke sich die Wirkung von Tonverbindungen u. s. w. vorstellen zu können. Dann sind alle diejenigen auszusondern, in denen die Empfänglichkeit durch Gründe erregt wird, die gänzlich außerhalb der Tonkunst liegen, z. B. schöner Ton eines Instruments. Musikalisches Gehör im engeren Sinne ist demnach die Fähigkeit, die zu einem Tonstück verbundenen Töne und Zusammenklänge so unterscheiden, vergleichen und zusammenfassen zu können, wie der Komponist sie unterschieden, verglichen und zusammengefaßt haben will.« Wie dies Mendel-Reißmann ohne Intervallsinn, Gedächtnis, Phantasie, ohne Freude an Klangschönheit zu stande bringen will, ist mir nicht einleuchtend.
Ich glaube, man muß alle diese Fähigkeiten betrachten, die notwendig sind, um einen Menschen musikalisch erscheinen zu lassen. Dazu gehört ein gewisses Maß von Interesse, ein gut funktionierender Empfindungs-Apparat, Gefühl für Klang-Schönheiten, ein gutes Gedächtnis für Tonhöhen, Intervalle, Melodien, Rhythmus, schließlich Phantasie und Produktivität. Welches Maß der einzelnen Faktoren für unseren Begriff »musikalisch« nötig ist, dies muß erst ermittelt werden, bevor man eine Definition wagen kann.
In allen Fragen der Musik-Psychologie wurde bisher der Weg eingeschlagen, den uns die allgemeine Psychologie wies. Stumpf hat in seiner berühmten Tonpsychologie die meisten der oben erwähnten Faktoren genauen Untersuchungen unterworfen und hat Empfindung, Urteil, Gedächtnis, Gefühl, alles besonders betrachtet und auf diese Weise sehr wichtige, allgemeinpsychologische Resultate gewonnen. Um aber in der Erkenntnis des Begriffs »Musikalisch« weiter zu kommen, müßte man nach meiner Ansicht noch die von Binet und Kraepelin erdachte Methode der Individualpsychologie zu Hülfe rufen. Was nützt es für die Analyse des musikalischen Sinnes zu wissen, daß die Unterschieds-Empfindlichkeit oder das Gedächtnis für Tonhöhen schwankt zwischen diesen und jenen Grenzwerten? Wir wissen darum noch nicht, von welchem Punkte dieser Skala an der Beobachter musikalisch zu nennen ist. Für unsere Frage wäre es rationeller, Menschen, die nach allgemeinem Urteil für musikalisch gelten, psychologisch zu untersuchen. Wenn wir so der Biographie unserer großen Musiker noch experimentell-psychologische Beiträge beilegen könnten, dann würden wir wahrscheinlich in der Erkenntnis der Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Faktoren des musikalischen Talentes bestehen, weiter vordringen.
Noch rationeller aber scheint es mir, den großen Typus des Musikalischen zu zerteilen in einzelne Untertypen. Das wäre keine willkürliche und künstliche Zerreißung des Haupttypus, sondern solche Untertypen bestehen, wie die Beobachtung, wie die psychologische Forschung zeigt. Die Untertypen entstehen dadurch, daß eine besondere Fähigkeit bei einer Reihe von Musikern besonders entwickelt ist und durch ihr Übergewicht ihren Einfluß ausübt auf die übrigen Faktoren des Musiksinnes. Die verschiedenen Gebiete des Gedächtnisses, des Gedächtnisses für absolute Tonhöhen, für Intervalle, für Harmonien, für Melodien, für Rhythmus dürften neben vielen anderen Ausgangspunkte für diese Typen-Psychologie der Musik bilden.
Eine dieser Fähigkeiten, das absolute Tonbewußtsein, haben wir soeben kennen gelernt und gesehen, daß dasselbe einen gewaltigen Einfluß auf die Intervall-Auffassung, das Gedächtnis für Harmonien und für Melodien ausübt, und daß es eine deutliche Beziehung zu der musikalischen Phantasie und kompositorischen Begabung aufweist. Die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker haben also nicht nur die Fähigkeit der Tonhöhen-Erkennung und der Tonvorstellung, sondern sie bilden einen ganz bestimmten musikalischen Typus. Solcher Typen giebt es mehrere, und sie alle müßten genau psychologisch untersucht werden; dann würden die Beziehungen zwischen den einzelnen Faktoren des musikalischen Talents genauer erkannt werden, und das ganze Gebiet des Musikalischen und sein Begriff würden eher der Erkenntnis erschlossen werden.
1) Stumpf, Tonpsychologie.
2) v. Kries, Über das absolute Gehör (Zeitschrift für Psychologie, III).
3) Wundt, Philosoph. Studien, Band III, S. 534 ff'.
4) E.Engel, Die Klangfarbe.
5) Stumpf, Tonpsychologie II. S. 408.
6) Stumpf, Tonpsychologie S. 312.
7) Vergl. Stumpf, Tonpsychologie I, S. 379.
8) Troelsch, Archiv I, S. 163.
9) Siehe Stumpf, Tonpsychologie I, S. 385.
10) Tonpsychologie I, S. 397.
11) Otto Abraham und Ludwig J. Brühl, Über kürzeste Töne und Geräusche (Zeitschrift für Psychologie, XVIII).
12) O.Abraham und K. L. Schaefer, Über die maximale Geschwindigkeit von Tonfolgen (Zeitschrift für Psychologie, XX).
13) Otto Abraham, Über das Abklingen von Tonempfindungen (Zeitschrift für Psychologie, XX).
14) v, Kries und Auerbach, über die Zeiten der einfachsten psychischen Prozesse (Arch. für Physiologie, 1877).
15) O. Abraham und Karl Schaefer, Über die maximale Geschwindigkeit von •Tonfolgen (Zeitschrift für Psychologie XX, S. 412).
16) Preyer, Grenzen der Tonwahrnehmung, S. 21.
17) Max Meyer, Über die Rauhigkeit tiefster Töne (Zeitschrift für Psychologie, Bd.XIII).
18) Richard Hennig, Die Charakteristik der Tonarten (Verlag Dümmler 1897).
19) Billroth, Wer ist musikalisch?
20) Helmholtz, Lehre von der Tonempfindung, S. 603.
21) Lotze. Medizinische Psychologie, 1852, S. 480.
22) G. E. Mueller, Zur Grundlage der Psychologie, S. 28S.
23) II, S. 15.
24) Anzeigen der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 1885, Nr. 14.
25) C. Jalm, W. A. Mozart, I. Aufl., 1856, 1. Band, S. 195.
26) Unser Apparat umfaßt die Oktave von 400--800 Schwingungen und enthält 120 Zungen, die zwischen 400 und 480 um je 2 Schwingungen, zwischen 480 und 600 um je 3, zwischen 600 und 800 um je 5 Schwingungen differieren.
27) J. v. Kries, Über das absolute Gehör, Zerbst, Band IV, S. 256.
28) Naubert, Das absolute Tonbewußtsein (Zeitschrift: Der Klavierlehrer 1898.
29) The Psychological Review, Vol. VI, p. 514--516. (1899.)
30) Zeitschrift für Psychologie in. S. 257, 279.
31) Siehe Stumpf, Tonpsychologie S. 305.
32) O. Abraham und L. J. Brühl, Wahrnehmung kürzester Töne und Ge räusche, a. a. O.
33) Munk, Monatsberichte der Berliner Akademie, 1881, S. 481. Siehe auch Stumpf, Tonpsychologie II, S. 289.
34) Siehe Stumpf, Tonpsychologie I, S. 203.
35) Siehe oben S. 34 ff.
36) Siehe Stumpf, Tonpsychologie I, S. 12.
37) Stumpf, Tonpsychologie I, S. 386.
38) Hanslick, Vom musikalisch Schönen.
39) Stumpf, Tonpsychologie II, S. 555.
40) Allgemeine Musikzeitung, 1898, Nr. 41.
41) »Die natürliche Stimmung in der modernen Vokalmusik« in der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft IX, S. 428.
42) Ich verstehe hierbei allerdings nicht die »doppelte Transposition«. Meiner Ansicht nach handelt es sich um eine einfache Transposition, entweder auf dem Klavier in eine höhere Tonart, oder im Gedächtnis in eine tiefere.
43) Mind and Body, London 1874, S. 208.
44) Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft VIII, S. 242.
45) Max Meyer, Über Tonverschmelzung und die Theorie der Konsonanz (Zeitschrift für Psychologie XVII, S. 413 und XVIII).
46) C. Stumpf, Die Unmusikalischen und die Tonverschmelzung (Zeitschrift für Psychologie, XIV, S. 425 und XVIII).